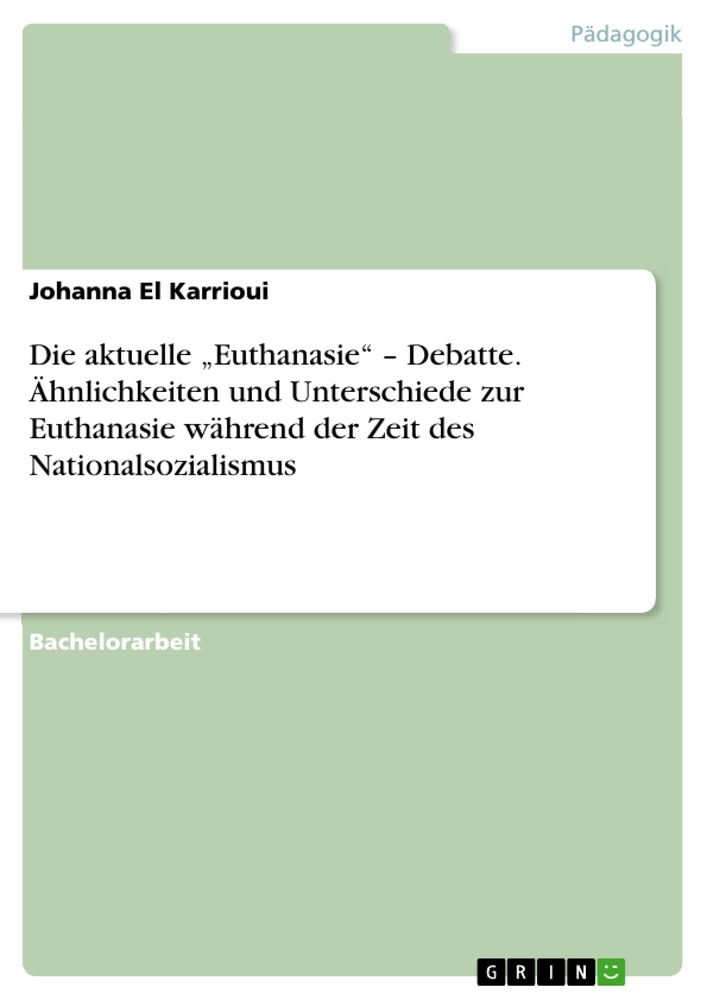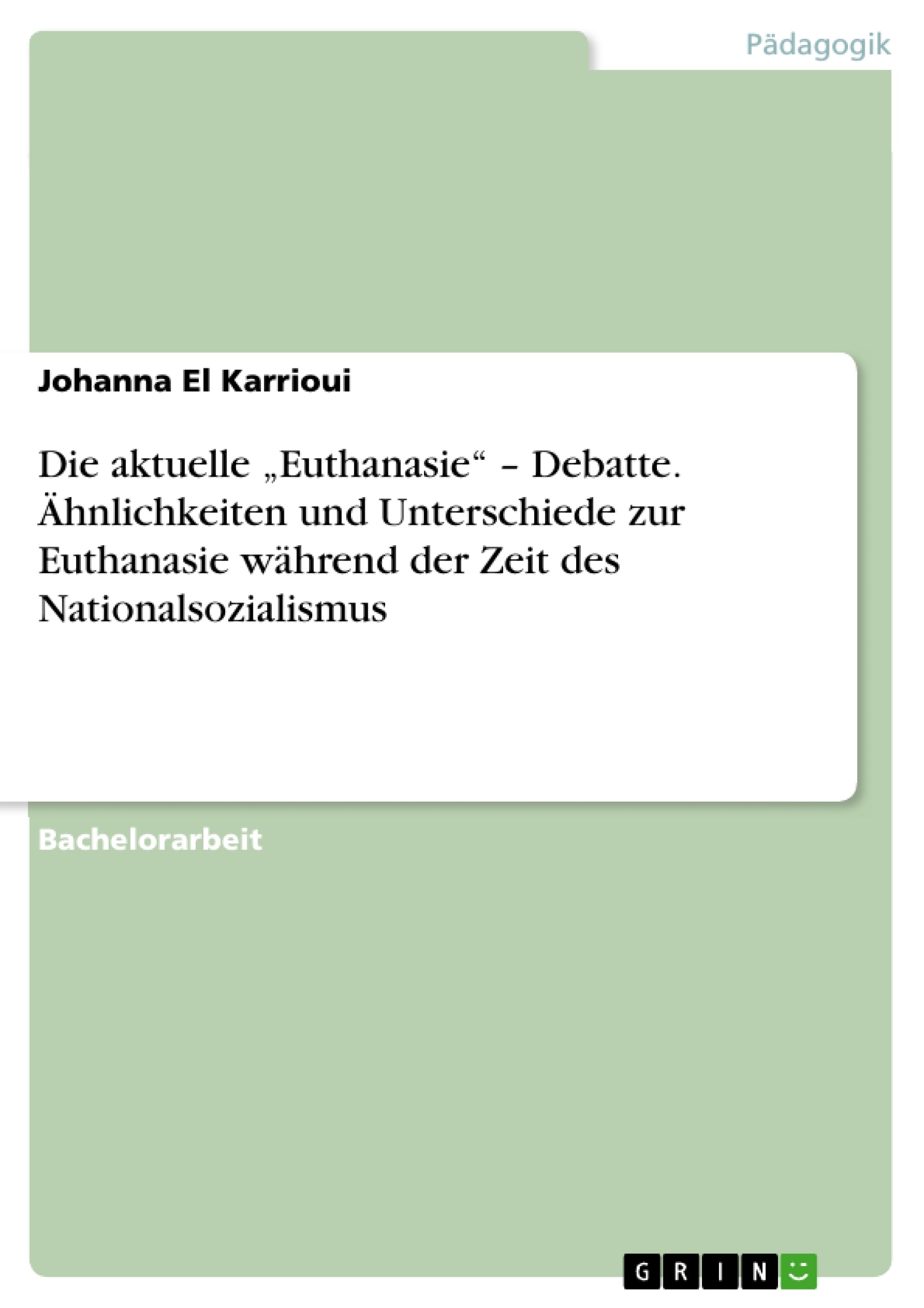Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich zum einen mit dem Thema der „Euthanasie“ während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland, der etwa 185.000 Menschen zum Opfer fielen. Zum anderen handelt sie von der zurzeit geführten sogenannten aktuellen Euthanasiedebatte. Darin geht es um die Abtreibung behinderter Föten, die Sterilisation sogenannter geistig behinderter Menschen und die Forderung nach Sterbehilfe für schwerkranke Personen.
Der erste Teil der Arbeit behandelt die aktuelle Euthanasiedebatte. Ich stelle verschiedene Methoden der pränatalen Diagnostik vor. Die Probleme, wenn festgestellt wird, dass der Embryo sich nicht wie gewünscht entwickelt sowie das oftmalige Resultat, die Abtreibung, werden erörtert. Danach lege ich die aktuelle deutsche Rechtslage zur Sterilisation bei Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung dar und erläutere sie.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt jedoch auf der Diskussion über die Sterbehilfe. In einem Rückblick in die Geschichte stelle ich vor, wie sich die Einstellung zu dieser Frage seit der Antike gewandelt hat. Danach wird die Rechtslage in Deutschland und in den Niederlanden, als ein Beispiel für ein Land, in dem es eine legale Möglichkeit der Sterbehilfe gibt, vorgestellt. Ich lege dar, wie die Gesellschaft in Deutschland zu diesem Thema steht und welche Organisationen sich gebildet haben, die die Idee der Sterbehilfe unterstützen oder ablehnen. Als Abschluss dieses Kapitels stelle ich eine mögliche Alternative zur Sterbehilfe vor: Hospize, in denen Menschen beim Sterben begleitet werden.
Das Thema des zweiten Teils ist die Sterilisation und Tötung so genannter erbkranker Menschen oder von so genanntem lebensunwerten Leben. Ich stelle die Vorgeschichte – den Sozialdarwinismus und die soziale Frage – und die verschiedenen Vorschläge zur „Lösung des Problems minderwertiger Menschen“ dar. Es folgen der Ablauf der verschiedenen Maßnahmen und die Reaktionen darauf. Ich suche nach einer Erklärung, warum viele Ärzte und Schwestern, die zum Wohl der Menschen in den Anstalten hätten arbeiten sollen, Tötungen durchgeführt oder dabei mitgeholfen haben.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
A Die aktuelle Euthanasiedebatte
1 Die pränatale Diagnostik (PND
2 Die Abtreibung: rechtliche Situation in Deutschland
2.1 Die Abtreibung aufgrund einer diagnostizierten Behinderung
2.2 Die Kritik an der Neuregelung des §218 StGB
3 Die Einbecker Empfehlungen
4 Die rechtliche Möglichkeit der Sterilisation von einem Menschen mit geistiger Behinderung
5 Die Sterbehilfe
5.1 Die Bewertung der Sterbehilfe in verschieden Epochen
5.2 Die Erläuterung von Begriffen
5.3 Die Sterbehilfe in Deutschland
5.3.1 Die gesetzlichen Regelungen zur Sterbehilfe
5.3.2 Die Einstellung der Bevölkerung zur Sterbehilfe.
5.3.3 Verschiedene Organisationen, die Sterbehilfe ablehnen, fordern oder anbieten
5.3.4 Die Verbindlichkeit der Patientenverfügung als Willens- erklärung
5.4 Die Sterbehilfe in den Niederlanden
5.4.1 Die rechtliche Grundlage und die Durchführung der Sterbehilfe
5.4.2 Eine kritische Würdigung des Artikels 293 und
5.4.3 Einige Organisationen, die die Durchführung von Sterbehilfe unterstützen oder ablehnen
5.5 Die Argumente von Befürwortern und Gegnern von Sterbehilfe
5.6 Hospize und Palliativmedizin als Alternativen zur Sterbehilfe
B „Euthanasie“ während der Zeit des National- sozialismus
1 Die Begriffsbedeutung und –wandlung von „Euthanasie“
2 Die Entwicklung zur “Euthanasie“
2.1 Der Sozialdarwinismus
2.2 Die soziale Frage
2.3 Das Leben der Anstaltsinsassen vor 1933
3 Die Vorschläge um die „Entartung“ der Gesellschaft zu verhindern
3.1 Die Idee der negativen Eugenik
3.2 Der Vorschlag der Sterilisation
3.3 Die NS-Familienpolitik
4 Die Verbreitung der Sozialeugenik in der Öffentlichkeit
5 Die Idee der Vernichtung „lebensunwerten Lebens“
5.1 Die gedanklichen Anstöße zur „Euthanasie“
5.2 Ein Gesetzesentwurf zur Sterbehilfe bei unheilbar Kranken
6 Die konkreten Vorbereitungen der „Euthanasie“
6.1 Die gesetzliche Grundlage und Hitlers Geheimschreiben
6.2 Die Erfassung der Betroffenen
6.3 Die Planung der Euthanasiemaßnahmen und deren aus- führende Organisationen
7 Die Durchführung der Euthanasiemaßnahmen
7.1 Die (Zwangs-)Sterilisation
7.2 Die Kindereuthanasie in den Kinderfachabteilungen
7.3 Die Aktion T4: das Töten erwachsener Behinderter
7.4 Die wilde Euthanasie und die Aktion Brandt
8 Das Anstaltspersonal
8.1 Die Möglichkeit, Bewohner zu schützen
8.2 Die Motivation des Personals. Ein Erklärungsversuch
9 Die Reaktionen der Bevölkerung auf die „Euthanasie“
10 Die Aufarbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg
10.1 Was wurde aus überlebenden Opfern?
10.2 Die Folgen für die Täter
C Vergleich von „Euthanasie“ im Zweiten Weltkrieg und der zurzeit geführten Debatte um PND, Abtreibung, Sterilisation geistig behinderter Menschen und Sterbehilfe
1 Die pränatale Diagnostik im Gegensatz zur willkürlichen Bestimmung „erbkranken Lebens“ durch die National- sozialisten
2 Die Abtreibung eines behinderten Fötus, heute eine freie Entscheidung?
3 Die Sterilisation eines geistig behinderten Menschen: 1937 und 2007
4 Abgrenzung von Sterbehilfe und „Euthanasie“
4.1 Die offensichtlichen Motive für die Gewährung von Sterbehilfe
4.2 Als verdeckte Motive: Denkprozesse und Ideologien
Glossar
Abkürzungsverzeichnis
Literaturangaben
English abstract
Persönliche Erklärung
Einleitung
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich zum einen mit dem Thema der „Euthanasie“ während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland, der etwa 185.000 Menschen zum Opfer fielen. Zum anderen handelt sie von der zurzeit geführten so genannten aktuellen Euthanasiedebatte. Darin geht es um die Abtreibung behinderter Föten, die Sterilisation so genannter geistig behinderter Menschen und die Forderung nach Sterbehilfe für schwerkranke Personen.
Der erste Teil der Arbeit behandelt die aktuelle Euthanasiedebatte. Ich stelle verschiedene Methoden der pränatalen Diagnostik vor. Die Probleme, wenn festgestellt wird, dass der Embryo sich nicht wie gewünscht entwickelt sowie das oftmalige Resultat, die Abtreibung, werden erörtert. Danach lege ich die aktuelle deutsche Rechtslage zur Sterilisation bei Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung dar und erläutere sie.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt jedoch auf der Diskussion über die Sterbehilfe. In einem Rückblick in die Geschichte stelle ich vor, wie sich die Einstellung zu dieser Frage seit der Antike gewandelt hat. Danach wird die Rechtslage in Deutschland und in den Niederlanden, als ein Beispiel für ein Land, in dem es eine legale Möglichkeit der Sterbehilfe gibt, vorgestellt. Ich lege dar, wie die Gesellschaft in Deutschland zu diesem Thema steht und welche Organisationen sich gebildet haben, die die Idee der Sterbehilfe unterstützen oder ablehnen. Als Abschluss dieses Kapitels stelle ich eine mögliche Alternative zur Sterbehilfe vor: Hospize, in denen Menschen beim Sterben begleitet werden.
Das Thema des zweiten Teils ist die Sterilisation und Tötung so genannter erbkranker Menschen oder von so genanntem lebensunwerten Leben. Ich stelle die Vorgeschichte – den Sozialdarwinismus und die soziale Frage – und die verschiedenen Vorschläge zur „Lösung des Problems minderwertiger Menschen“ dar. Es folgen der Ablauf der verschiedenen Maßnahmen und die Reaktionen darauf. Ich suche nach einer Erklärung, warum viele Ärzte und Schwestern, die zum Wohl der Menschen in den Anstalten hätten arbeiten sollen, Tötungen durchgeführt oder dabei mitgeholfen haben.
In diesem Teil der Bachelorarbeit berufe ich mich häufig auf ein Buch, das schon vor 20 Jahren geschrieben wurde, das aber sehr ausführlich die Geschehnisse und die Entwicklung dorthin schildert. Damit tue ich es vielen Autoren gleich, die ihre Bücher erst in den letzten Jahren verfasst haben, sich aber ebenfalls auf das Buch „Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie“ von Hans–Walter Schmuhl beziehen.
Hier tauchen viele Begriffe, die heute so nicht mehr gesagt würden. Beispiele sind die Wörter Insassen oder Idiotie. Ich nutze sie trotzdem, auch wenn sie heute nicht mehr korrekt sind, um dem Leser ein besseres Bild der damaligen Zeit vermitteln zu können. Zum anderen gibt es Begriffe, die von den Nationalsozialisten instrumentalisiert wurden und die heute aus diesem Grund vermieden werden. Diese habe ich in Anführungsstriche gesetzt. Beispielsweise sind dies die Begriffe lebensunwert, erbkrank oder minderwertig, aber auch das Wort Euthanasie, wie es von den Nationalsozialisten genutzt wurde.
Der dritte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich der beiden vorgestellten Themenkomplexe. Die Frage hierbei ist, ob die derzeit geführte Diskussion etwas grundlegend anderes fordert, als vor 70 Jahren in Deutschland durchgeführt wurde. Hat die Gesellschaft aus der Geschichte gelernt, oder wird hier nur mit dem Wort der Sterbehilfe beschönigt, dass es die gleiche „Euthanasie“ wie 1939 bis 1945 ist?
A Die aktuelle Euthanasiedebatte
Zurzeit wird verstärkt über die ethische Vertretbarkeit, Embryonen aufgrund einer vermuteten Behinderung abzutreiben oder schwerbehinderte Neu- geborene unversorgt sterben zu lassen, debattiert. Ebenso, ob es ethisch vertretbar ist, behinderte Menschen zu sterilisieren, damit sie keinen Nachwuchs bekommen, oder schwerkranke Menschen durch Sterbehilfe von ihrem Leiden zu erlösen.
1 Die pränatale Diagnostik (PND)
Durch vorgeburtliche Untersuchungen kann heutzutage bereits viel über den Gesundheitszustand des Embryos ausgesagt werden. Dies birgt, neben der möglichen Beruhigung der werdenden Eltern, aber auch die Gefahr, sich für oder gegen ein behindertes Kind entscheiden zu müssen, wenn der Arzt eine Anomalie feststellt.
Es gibt verschiedene Methoden, vorgeburtlich etwas über den Gesundheitszustand des Fötus herauszufinden. Dazu zählen unter anderem die Ultraschall- oder die Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese), die Untersuchung des Chorionzottengewebes sowie Blutuntersuchungen. Je nach Untersuchungsart können unterschiedliche Erkenntnisse gewonnen werden, die Methoden können zu unterschiedlichen Zeitpunkten angewandt werden und bergen individuelle Risiken, eine Fehlgeburt auszulösen. (Vgl. Mattisseck–Neef 2006, 124ff)
Diese Arbeit wird nicht konkreter auf diese Fragen eingehen, sondern beschränkt sich auf die möglichen Folgen der Diagnose, dass der Fötus von der Norm abweicht.
Die verschiedenen Methoden der pränatalen Diagnostik sind inzwischen weitgehend akzeptiert und angewandt. Ärzte wurden bereits auf Schadensersatz verklagt, wenn die Frau ein behindertes Kind zur Welt gebracht hat, obwohl während der Untersuchung nichts Auffälliges festgestellt wurde. Diese wurde unter der wrongful–life–Rechtssprechung bekannt. (Vgl. Benthaus/Griep/Wegener 1992, 27f)
Folgend möchte ich nun verschiedene Argumente vorstellen, die von Befürwortern und Gegnern einer pränatalen Diagnostik vorgebracht werden.
Ein Argument der Befürworter ist, dass die Eltern sich auch bewusst für ein behindertes Kind entscheiden können. Weiter führen sie an, dass durch eine pränatale Untersuchung und der folgenden Abtreibung dem behinderten Kind ein Leben voller Leid und seiner Familie die schwere Aufgabe der Pflege erspart werden kann. (Vgl. Benthaus/Griep/Wegener 1992, 39)
Allerdings lässt sich nach einer pränatalen Untersuchung nicht das subjektive Erleben oder die Schwere einer Behinderung vorhersagen, da diese in einer Beziehung zu sozialen, psychischen und Umweltfaktoren steht. (Vgl. Schockenhoff 1993, 239) Und Eltern behinderter Kinder erleben ihre Rolle nicht zwingendermaßen als aufopfernd, sondern durchaus voller Freude.
Des Weiteren führen Gegner an, dass für die meisten Beeinträchtigungen, die durch eine pränatale Untersuchung erkannt werden können, keine Therapiemöglichkeiten bestehen. (Vgl. Mattisseck–Neef 2006, 132) Deshalb sei „die eugenisch begründete Abtreibung die einzige ‚Therapie’“. (Benthaus/Griep/Wegener 1992, 28) Und viele Eltern, die eine für sie negative Diagnose gestellt bekommen, überlegen gar nicht mehr, ob dieses Kind für sie zumutbar ist, sondern entscheiden sich sofort für eine Abtreibung. (Vgl. Schockenhoff 1993, 243)
Die Eltern wiederum, die ein behindertes Kind austragen wollen, erleben oft von Seiten der Gesellschaft Unverständnis für diese Entscheidung und stehen unter Druck, dieses aus ihrer Sicht vermeidbare Unglück zu verhindern. Möglicherweise stehen dabei auch finanzielle Interessen im Vordergrund, denn die Allgemeinheit muss die Kosten für ein behindertes Kind tragen. (Vgl. Mattisseck–Neef 2006, 136) So fragen Hirsch und Eberbach[1]: „Weshalb sollte ‚die Gesellschaft’, die Solidargemeinschaft der Versicherten, bezahlen müssen, wenn ein Paar sich den vermeidbaren ‚Luxus’ eines erbkranken Kindes leistet?“. (Hirsch/Eberbach zit. nach Sierk 1993, 121)
Die Gegner der PND führen an, dass 97% aller Neugeborenen ohne Schädigung zur Welt kommen. Von den verbleibenden 3% entstehen 94 bis 98 % aller Behinderungen während der Schwangerschaft oder bei der Geburt. Von den genetisch verursachten Schädigungen sind nur 0,4% vorgeburtlich erkennbar. (Vgl. Mattisseck–Neef 2006, 122f) Überhaupt entstehen 90% aller Behinderungen nach der Geburt. (Vgl. Benthaus/Griep/Wegener 1992, 5) So lautet ein weiteres Argument der Gegner: „Warum sollte man das Risiko einer Fehlgeburt eingehen?“
2 Die Abtreibung: rechtliche Situation in Deutschland
Nach derzeitiger Gesetzgebung ist ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland strafbar. Er wird jedoch nicht sanktioniert, wenn die Schwangere drei Bedingungen erfüllt: sie muss an einer gesetzlich vorgeschriebenen Beratung teilgenommen haben, die Abtreibung muss durch einen Arzt durchgeführt werden und seit der Empfängnis dürfen höchstens zwölf Wochen vergangen sein. (Vgl. Mattisseck–Neef 2006, 83)
2.1 Die Abtreibung aufgrund einer diagnostizierten Behinderung
Bis August 1995 gab es die so genannte eugenische Indikation, nach der ein Fötus wegen seiner Behinderung abgetrieben werden konnte. (Vgl. Mattisseck–Neef 2006, 66) Seit 1995 fällt dies in den Bereich der medizinischen Indikation. Nach dieser bleibt die Abtreibung straffrei, wenn diese „nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden.“ (§218a Abs. 2 StGB)
Damit liegt der Grund für die Schwangerschaftsunterbrechung darin, dass die Mutter in ihrem derzeitigen körperlichen oder psychischen Zustand den Belastungen eines Kindes mit einer Behinderung nicht gewachsen wäre. Die medizinische Indikation muss durch einen Arzt bescheinigt werden. Die Schwangere kann unter dieser Bedingung einen Abbruch bis zum Ende der Schwangerschaft durchführen lassen, ohne dass eine Beratung nötig wäre. (Vgl. Weigert 2006, 151)
Die Evangelische Kirche in Deutschland äußerte sich 1987 wie folgt zum Thema humangenetische Beratungsstellen und Abtreibung:
Humangenetische Beratung soll gewährleisten, dass das Lebensrecht auch eines Behinderten geachtet und mit der pränatalen Diagnostik nicht automatisch die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch im Falle einer festgestellten Fehlbildung verbunden wird. (Evangelische Kirche in Deutschland zit. nach Schmidtke 1997, 287)
2.2 Die Kritik an der Neuregelung des §218 StGB
Die Abschaffung der eugenischen Indikation kann aus verschiedenen Gründen hinterfragt werden. 1995 geschah dies aufgrund der Kritik von Behindertenverbänden, dass mit der damaligen Regelung der Wert eines behinderten Babys geringer angesetzt sei als der eines gesunden. (Vgl. Mattisseck–Neef 2006, 85) Es kann aber angemerkt werden, dass die Fälle der eugenischen nun in der medizinischen Indikation aufgehen und es Menschen gibt, die meinen, dass es „gleich sei, ob die Schwangerschaft mit einem geschädigten Föten wegen der Unzumutbarkeit der Schädigung oder aufgrund der aus der Schädigung resultierenden Belastungen abgebrochen werde.“ (Mattisseck–Neef 2006, 101)
Des Weiteren wird kritisch angemerkt, dass im Fall einer medizinischen Indikation keine Beratungspflicht besteht. Doch gerade durch ein möglicherweise behindertes Baby könnten zukünftige Eltern überfordert werden und sich vorschnell für eine Abtreibung als einziger Lösung entscheiden. (Vgl. Mattisseck–Neef 2006, 197) Gerade hier scheint eine Beratung notwendig.
Diese Neuregelung des Gesetzes führt zu dem Problem, dass Föten, die aufgrund medizinischer Indikation erst wenige Wochen vor der natürlichen Geburt abgetrieben werden, durchaus lebensfähig wären. Käme ein lebendes Baby auf die Welt müsste es medizinisch versorgt und am Leben erhalten werden, obwohl es abgetrieben werden sollte. (Vgl. Mattisseck–Neef 2006, 109) Um dies zu vermeiden, muss es bereits im Bauch der Schwangeren getötet werden (so genannter Fetozid). Deshalb werden Forderungen laut, Spätabtreibungen zu verbieten, wenn dabei ein lebensfähiges Baby auf die Welt kommen könnte.
Des Weiteren wird eine Abtreibung nach der 16. Schwangerschaftswoche meist durchgeführt, indem der Schwangeren wehentreibende Mittel gegeben werden und dadurch eine Geburt eingeleitet wird. Die Behandlung kann sich über Tage hinziehen, ist für die Schwangere schmerzhaft und vor allem psychisch stark belastend. (Vgl. Lux 2005, 45ff)
Lösungsvorschläge zur Beseitigung dieser Kritikpunkte gibt es viele. Sie reichen von der strengeren Festlegung dessen, was unter die medizinische Indikation fallen soll, über die Einschränkung der Durchführung von pränataler Diagnostik bis hin zur Einführung einer Fristenregelung. Auch die zwangsweise medizinische Behandlung der Behinderung des Embryos vor einem Schwangerschaftsabbruch oder die verpflichtende Teilnahme an einem Beratungsgespräch vor einer Abtreibung werden diskutiert. (Vgl. Mattisseck–Neef 2006, 172ff)
3 Die Einbecker Empfehlungen
1986 fand im niedersächsischen Einbeck ein Expertengespräch der Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht statt. Dort wurden Empfehlungen über „Grenzen der ärztlichen Behandlungspflicht bei schwerstgeschädigten Neugeborenen“ (Deutsche Gesellschaft für Medizinrecht zit. nach Mattisseck-Neef 2006, 271) formuliert, diskutiert und verabschiedet. Obwohl das Recht auf Leben höchste Wertigkeit habe und somit „die Lebenserhaltung vorrangige ärztliche Aufgabe“ (Mattisseck–Neef 2006, 271) sei, gebe es Situationen, in denen die Behandlungsmöglichkeiten nicht voll ausgeschöpft werden müssen. (Vgl. Mattisseck–Neef 2006, 271) Kriterien waren, wenn
1. das Leben dadurch nicht auf Dauer erhalten werden kann, sondern nur der sichere Tod hinausgezögert wird, […]
2. es trotz der Behandlung ausgeschlossen ist, daß das Neugeborene jemals die Fähigkeit zur Kommunikation mit der Umwelt erlangt, […]
3. die Vitalfunktionen des Neugeborenen auf Dauer nur durch intensivmedizinische Maßnahmen aufrechterhalten werden können, […] (Einbecker Empfehlungen zit. nach Mattisseck–Neef 2006, 271)
1992 wurden die Einbecker Empfehlungen von der Akademie für Ethik in der Medizin, der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und der Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht überarbeitet. Die Verpflichtung zur Lebenserhaltung und das Verbot aktiver Maßnahmen um das Leben des Kindes zu beenden, wurden beibehalten. Die Kriterien, wann auf eine Behandlung des Neugeborenen verzichtet werden kann, sind in der neuen Version allgemeiner formuliert. (Vgl. Mattisseck–Neef 2006, 272)
4 Die rechtliche Möglichkeit der Sterilisation von einem Menschen mit geistiger Behinderung
Im §1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) werden die Rahmenbedingungen für die Sterilisation von gesetzlich betreuten Menschen, was zumindest auf einen Teil der Menschen mit einer geistigen Behinderung zutrifft, festgelegt. Dort heißt es, dass, wenn der Betreute selbst dem Eingriff nicht zustimmen kann, z.B. weil er die Sinnhaftigkeit nicht nachvollziehen kann, der gesetzliche Betreuer nur einwilligen darf, wenn
1. die Sterilisation dem Willen des Betreuten nicht widerspricht,
2. der Betreute auf Dauer einwilligungsunfähig bleiben wird,
3. anzunehmen ist, dass es ohne Sterilisation zu einer Schwangerschaft kommen würde,
4. infolge dieser Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren zu erwarten wäre, die nicht auf zumutbare Weise abgewendet werden könnte, und
5. die Schwangerschaft nicht durch andere zumutbare Mittel verhindert werden kann.
(§1905 BGB)
In allen anderen Fällen stellt eine Sterilisation eine Körperverletzung dar und ist eine Verletzung des Grundrechtes auf körperliche Unversehrtheit.
Ein behinderter Mensch, der den Zusammenhang von Sexualität und Schwangerschaft versteht und diese für sich ausschließen möchte, kann selbst den Antrag auf Unfruchtbarmachung stellen. Er fällt nicht unter das Betreuungsrecht.
Nun werde ich die fünf Bedingungen, unter denen eine Sterilisation nach §1905 BGB durchgeführt werden kann, beleuchten.
1.) Den Willen oder Unwillen kann der Betroffene sowohl verbal als auch durch Gesten, Mimik, Gebärden, Gefühlsäußerungen oder körperlichen Widerstand ausdrücken. Wenn zu erkennen ist, dass er den Eingriff ablehnt, darf dieser nicht durchgeführt werden. (Vgl. Hoffmann 1996, 100)
2.) Solange keine sexualpädagogische Aufklärung stattfand, kann der Betroffene nicht einwilligungsfähig sein. Deshalb sollte im konkreten Fall einer möglichen Sterilisation nachgewiesen werden, dass Versuche in diese Richtung unternommen wurden. (Vgl. Hoffmann 1996, 97) Zumal im §1901 Absatz 3 Satz 3 BGB geregelt ist, dass der Betreuer alle wichtigen Angelegenheiten des Betreuten mit diesem bespricht. (Vgl. Hoffmann 1996, 80) Insofern ist der Betreuer also verpflichtet, sich mit dem Betreuten zu befassen und ihm den Sinn und Zweck der Sterilisation zu erklären, um ihn nach Möglichkeit in dieser Frage einwilligungsfähig zu machen.
3.) Um annehmen zu können, dass es ohne Sterilisation zu einer Schwangerschaft kommen wird, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: die Frau muss 1. fruchtbar sein und 2. genitalsexuelle Kontakte haben. Eine vorsorgliche Sterilisation, z.B. allein aufgrund einer gemischtgeschlechtlichen Wohngruppe, ist nicht zulässig. (Vgl. Hoffmann 1996, 104f)
4.) Die Gefahr einer körperlichen Schädigung durch eine Schwangerschaft ist gelegentlich gegeben, durch die moderne Medizin jedoch geringer geworden. (Vgl. Hoffmann 1996, 110f) Wesentlicher ist die Frage des psychischen Leidens, wenn der behinderten Mutter ihr Kind zu dessen Wohl abgenommen wird. Dazu muss schon vor der Sterilisation sicher sein, dass die Mutter ihr Kind nicht behalten dürfte und dass sie unter der Trennung leiden würde. Sind nicht beide Punkte gewiss, darf die Sterilisation nicht durchgeführt werden. (Vgl. Hoffmann 1996, 113)
5.) Angesichts der Fülle an verschiedenen, auch lang wirkenden, Methoden, wie zum Beispiel der Spirale oder des Verhütungsstäbchens, sollte für jeden Menschen eine passende Möglichkeit der Verhütung gefunden werden können, die nicht so endgültige wie die Sterilisation ist.
Weiterhin ist nach §1631c BGB eine Sterilisation von Minderjährigen verboten. Dies wird damit begründet, dass keine Aussage über ein mögliches späteres Erlangen der Einsichtsfähigkeit gemacht werden kann. Dies bedeutet implizit, dass bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres ebenfalls auf andere Weise als durch Sterilisation verhütet werden muss. (Vgl. Hoffmann 1996, 80f)
Nur, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, darf eine Sterilisation an einem geistig behinderter Erwachsenen durchgeführt werden.
Eine Bewertung dieser Gesetzgebung erfolgt im Kapitel 3 des Teils C.
5 Die Sterbehilfe
Den Schwerpunkt in der aktuellen Euthanasiedebatte lege ich in dieser Arbeit auf die Diskussion über Sterbehilfe. Der Leser soll sich ein Bild davon machen können, welche Formen der Sterbehilfe es gibt und wie die rechtliche Situation sowie die Einstellung in der Bevölkerung dazu ist.
5.1 Die Bewertung der Sterbehilfe in verschiedenen Epochen
Bereits in der griechischen und römischen Antike gab es die Vorstellung, dass ein selbst gewähltes und rasches Sterben wünschenswert sei. So forderte Euripides (484 – 406 v. Chr.), dass die Menschen sich vom Leben entfernen, wenn sie keinen Nutzen mehr für die Welt haben. Platon (427 – 347 v. Chr.) verlangte in seinem Werk „Politeia“, dass Ärzte nur Patienten behandeln, die körperlich stark sind. Die Schwachen, dazu zählte er auch schwache oder behinderte Säuglinge, solle man sterben lassen oder töten. Hierbei war das entscheidende Kriterium das Wohl des Staates.
Der bekannte hippokratische Eid (ca. 400 v. Chr. entstanden) wird von Gegnern der Sterbehilfe gerne angeführt wegen seines Passus’, dass die ärztliche Kunst nicht zum Töten eines Menschen oder zur Abtreibung genutzt werden darf. Er enthält aber die Empfehlung, bei unheilbar Kranken keine Behandlung mehr durchzuführen und gibt Ratschläge zur Schmerzlinderung.
Älter als dies ist jedoch die Vorstellung der Seelenwanderung der Pytagoreer. Da sie glaubten, dass die Seele sich nicht eigenmächtig vom Körper trennen dürfe, sondern erst durch einen von den Göttern bestimmten Tod, konnten sie weder die Fremd– noch die Selbsttötung oder die Beihilfe dazu gutheißen.
Auch im Judentum Christentum und Islam war und ist der Suizid sowie die Beihilfe zum Selbstmord verboten. Erklärung dafür ist der Glaube, dass allein Gott über Leben und Tod entscheiden darf. Die Hilfe zur Selbsttötung ist auch dann nicht erlaubt, wenn der todkranke Patient ausdrücklich darum bittet. Allerdings darf in diesem Stadium eine aktive Behandlung in Form von Operationen unterlassen werden.
Befürworter der Euthanasie beziehen sich oft auf Thomas Morus (1478 – 1535) oder Francis Bacon (1561 – 1626). Morus’ bekanntestes Werk „Utopia“ beschreibt einen nicht existierenden Staat, in dem unheilbar Kranke aufgefordert werden, ihr Leben und damit ihr Leiden selbst zu beenden oder durch andere beenden zu lassen. Dieses Sterben ist jedoch freiwillig, niemand wird dazu gezwungen. Bacon befand als erster, dass die Vorbereitung des kranken Menschen auf seinen bevorstehenden Tod zu den Aufgaben eines Arztes gehört. Auch die Linderung der Schmerzen durch Schmerz- oder Betäubungsmittel um dem Patienten „zu einem sanften und ruhigen Übergang in ein anderes Leben zu verhelfen“ (Payk 2004, 89) zählte er zu der Euthanasia medica.
Bacons Forderung der Medikamentengabe wurde in der Folgezeit konträr diskutiert. Befürwortern, die den Tod so leicht und erträglich wie möglich machen wollten, standen Gegner gegenüber, die eine Medikamentengabe ablehnten, aufgrund deren der Tod schneller eintreten könnte.
Einen neuen Anstoß bekam die Diskussion um die Sterbehilfe im 19. Jahr- hundert, als die Angst vor einer Negativauslese größer wurde. Man befürchtete, dass durch die Behandlung und Pflege Schwerkranker und Behinderter diese sich verstärkt fortpflanzen könnten, ihre Zahl dadurch zunehmen würde und die Kosten dafür der Bevölkerung nicht mehr zuzumuten seien.
Auch heute gibt es Diskussionen zur Legalisierung der Sterbehilfe. Entsprechende Änderungen der Gesetze zugunsten der Tötung unheilbar Kranker gab es bisher in der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Teilen der USA. (Vgl. Payk 2004, 81ff) Auf die Gesetzgebung in Deutschland werde ich im folgenden Kapitel eingehen. Auch die Durchführung der Sterbehilfe in den Niederlanden, als ein Beispiel für ein Land, in dem es eine gesetzliche Regelung gibt, werde ich in einem Abschnitt darlegen. (Siehe dazu Kapitel 5.4)
5.2 Die Erläuterung von Begriffen
Im Bereich der Sterbehilfe gibt es drei wichtige Unterscheidungen. Um Irritationen in den folgenden Kapiteln zu vermeiden, will ich diese drei Begriffe kurz vorstellen und ihre Bedeutung erläutern.
Aktive Sterbehilfe bedeutet, dass auf Wunsch des Patienten dessen Leben beendet wird. (Vgl. Koch 2005, 120) Dies geschieht durch eine aktive Tätigkeit des Sterbehilfe Leistenden, z.B. durch die Gabe von Gift.
Die passive Sterbehilfe ist das Unterlassen von Maßnahmen, die das Leben eines todkranken Menschen verlängern, aber nicht retten, würden. (Vgl. Koch 2005, 120) Ein Beispiel für passive Sterbehilfe ist das Nichtanschließen oder auch das Abstellen eines Beatmungsgerätes oder der künstlichen Ernährung. (Vgl. Putz/Steldinger 2004, 150)
Unter indirekter Sterbehilfe wird verstanden, dass ein Arzt seinem Patienten Medikamente gibt, die sein Leiden lindern sollen, z.B. Schmerzmittel, die aber eventuell ein früheres Sterben des Patienten bewirken können. (Vgl. Koch 2005, 120) Es wird also abgewogen zwischen dem Gut der Schmerzfreiheit oder –linderung und dem Gut der Lebenserhaltung. (Vgl. BIOSKOP 2002, 93)
Nun folgen noch drei der Sterbehilfe verwandte Begriffe, die ich auch kurz beleuchten möchte. Der eine ist die Beihilfe zum Selbstmord, wobei die entscheidende Handlung vom Suizidanten selbst ausgeführt werden muss. Das Verschreiben von Medikamenten, die für die Therapie benötigten werden und die der Patient zur Selbsttötung einnimmt, gilt nicht als Beihilfe zum Suizid. (Vgl. Koch 2005, 120ff) Der andere Begriff ist die Sterbebegleitung, also die medizinische und pflegerische Versorgung sowie die soziale Betreuung eines Menschen in seinen letzten Lebenstagen oder –wochen. (Vgl. Putz/Steldinger 2004, 154)
Das Wort Euthanasie bedeutet wörtlich übersetzt schöner Tod. (Brockhaus 1997, 714) Ausführlicher werde ich darauf im Teil B eingehen. Heute wird es häufig als Synonym für Sterbehilfe genutzt.
5.3 Die Sterbehilfe in Deutschland
In der Bundesrepublik Deutschland ist die aktive Sterbehilfe strafbar. Wie andere Fälle geregelt sind, ob die Bevölkerung eine Änderung der Gesetze wünscht, welche Organisationen dies ebenfalls fordern oder ablehnen und wie Alternativen aussehen könnten, wird im Folgenden dargestellt.
5.3.1 Die gesetzlichen Regelungen bezüglich der Sterbehilfe
Aktive Sterbehilfe fällt unter die Paragraphen für Totschlag (§212 StGB) oder Tötung auf Verlangen (§216 StGB). (Vgl. Koch 2005, 121f)
Passive Sterbehilfe, also das Unterlassen von lebensverlängernden Maßnahmen, bleibt immer dann straffrei, wenn dies dem Willen des Patienten entsprach. Wenn dies nicht der Fall war, kann die Nichtbehandlung durch den Arzt als unterlassene Hilfeleistung (§323c StGB) und Tötung durch Unterlassen (§13 StGB) angesehen und der Arzt angeklagt werden. Der Wunsch des Patienten nach Abbruch der Behandlung muss schriftlich oder mündlich klar formuliert werden. (Vgl. Payk 2004, 188)
Auch die Medikation zur Leidenslinderung, durch die der Tod eventuell früher eintritt, die indirekte Sterbehilfe, ist in Deutschland straflos. Der Unterschied zur aktiven Sterbehilfe liegt allein in der Intention des Arztes. Erfolgt die Medikamentengabe zur Linderung der Schmerzen unter Inkaufnahme des früher eintretenden Todes des Patienten, so handelt es sich um die straflose Form der indirekten Sterbehilfe. Handelt der Arzt in dem Wunsch, den Patienten zu töten, sprechen wir von strafbarer aktiver Sterbehilfe. (Vgl. Putz/Steldinger 2004, 152)
5.3.2 Die Einstellung der Bevölkerung zur Sterbehilfe
Die Ergebnisse von Untersuchungen, wie die Meinung in der Bevölkerung zur Frage der Sterbehilfe ist, sind sehr unterschiedlich.
Im März 1994 bat das Forsa Institut in Dortmund 1.004 Deutschen um ihre Meinung zu der Aussage: „Sterbehilfe bei unheilbar Kranken sollte erlaubt sein, wenn diese sie ausdrücklich wünschen.“ 83% der Befragten bejahten diese Aussage, 10% verneinten sie, die verbleibenden 7% machten dazu keine Aussage.
Die zweite Frage des Forsa Institutes lautete: „Wer sollte über die Sterbehilfe entscheiden?“ Die meisten Befragten (41%) wollten die Verantwortung einem nahen Angehörigen oder Freund übergeben, 29% sprachen sich für den behandelnden Arzt aus, 20% für eine unabhängige Ethikkommission. (Vgl. Beine 1998, 262)
In einer im Mai 2004 von Emnid im Auftrag der Deutschen Hospizstiftung durchgeführte Befragung befürworteten 34% die aktive Sterbehilfe, wohingegen das Forsa Institut im Jahr 2002 im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben (siehe auch Kapitel 5.3.3) eine Zustimmung von 82% für eine gesetzliche Regelung der Sterbehilfe in Deutschland ermittelte. (Vgl. Giese 2005, 19)
In einem Spiegel von 2007 wird unter dem Titel „Mehrheit für ärztliche Sterbehilfe“ angegeben, dass 76% von rund 1.000 Befragten sich dafür aussprachen, „unheilbar erkrankte[n] Menschen mit eng begrenzter Lebenserwartung die Möglichkeit [zu] geben, mit ärztlicher Hilfe ihr Leben selbst zu beenden“. (Spiegel 2007, 153) Nur 19% sprachen sich dagegen aus. (Vgl. Spiegel 2007, 153)
Diese Zahlen zu vergleichen ist nicht möglich, da nie die exakt gleiche Fragestellung gewählt wurde. Es bleibt nur zu vermuten, dass die Fragestellung dem gewünschten Ergebnis entsprechend formuliert werden kann.
5.3.3 Verschiedene Organisationen, die Sterbehilfe ablehnen, fordern oder anbieten
Wie wir gesehen haben, ist die Gesellschaft in der Frage der Sterbehilfe gespalten. So ist es nicht verwunderlich, dass sich Vereine gegründet haben, die die verschiedenen Positionen vertreten. Einige Organisationen möchte ich nun vorstellen.
Eine Befürworterin der Sterbehilfe und der Überarbeitung der derzeitigen rechtlichen Regelungen in Deutschland ist die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben (DGHS). Sie betont das Selbstbestimmungsrecht bis in die Sterbensphase und fordert ein Recht auf humanes Sterben mit Beistand und Begleitung. Der Wille des Patienten soll im Bezug auf lebenserhaltende oder –verlängernde Maßnahmen maßgeblich sein. Unter bestimmten Vorraus- setzungen befürwortet die DGHS auch die aktive Sterbehilfe. (Vgl. Koch 2005, 161) Folgende Änderungen im Gesetzbuch schlägt sie vor: Einerseits wünschen sie eine Stärkung des Rechts auf Selbstbestimmung des Patienten. Andererseits sollen die Menschen vor Sterbehilfe geschützt werden, die ohne ihre Zustimmung oder gegen ihren Willen durchgeführt wird. Kein Arzt soll verpflichtet werden können, Sterbehilfe zu leisten. Die unterlassene Hilfeleistung bei einer Selbsttötung möchte die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben straffrei wissen. (Vgl. BIOSKOP 2002, 36)
Die beiden Vereine „Exit“ und „Dignitas – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig sterben“ haben ihren Sitz jeweils in der Schweiz. Sie bieten so genannte Freitodbegleitung für Menschen bei „hoffnungsloser Prognose, unerträglichen Beschwerden oder unzumutbarer Behinderung“ (Exit zit. nach BIOSKOP 2002, 38) an. Dies ist nach schweizer Recht zulässig, solange es nicht aus selbstsüchtigen Motiven geschieht. Der betreffende Mensch bekommt von einem Vertrauensarzt des Vereins ein Rezept über die tödliche Dosis eines Medikamentes, das er in Anwesenheit eines so genannten Freitodbegleiters einnimmt. (Vgl. BIOSKOP 2002, 38ff)
Dem entgegengesetzt engagiert sich der Club of Life. Er fordert Therapie bis zuletzt, da sonst der Weg freigemacht würde für aktive Sterbehilfe. Palliative Therapie (siehe dazu Kapitel 5.6) sieht der Club of Life bereits als passive Sterbehilfe. Er argumentiert, dass es keine genetisch bedingte Altersgrenze des Menschen gäbe, so dass durch Forschung die Lebenserwartung erhöht werden könne. (Vgl. Zielinski 1993, 35f)
Der Verein „OMEGA – mit dem Sterben leben e.V.“ lehnt die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen ab, in denen um das Unterlassen von lebens- verlängernden Maßnahmen im nicht einwilligungsfähigen Zustand gebeten wird. Vielmehr unterstützt er die Palliativmedizin und das Sterben in angenehmer Atmosphäre. (Vgl. Koch 2005, 163)
5.3.4 Die Verbindlichkeit der Patientenverfügung als Willens- erklärung
Der Abbruch einer Behandlung, also die passive Sterbehilfe, gilt als Tötung durch Unterlassen und ist in Deutschland strafbar, wenn dies nicht dem Willen des Patienten entsprach. (Vgl. Payk 2004, 188) Ebenso ist jeder Eingriff ohne die Zustimmung des Betroffenen oder seines gesetzlichen Betreuers ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und als Körper- verletzung ebenfalls strafbar. (Vgl. Ankermann 2004, 54) Durch das Verfassen einer Patientenverfügung im geistig klaren Zustand kann festgehalten werden, in welcher Situation eine weitere Behandlung gewünscht oder abgelehnt wird. So hofft man, verhindern zu können, dass etwas gegen den Willen oder die innere Einstellung des Menschen geschieht, wenn dieser selbst nicht mehr seinen Willen äußern kann.
Patientenverfügungen sind in Deutschland bisher rechtlich nicht bindend. Jedoch hat der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs 2003 den Abbruch lebenserhaltender oder -verlängernder Maßnahmen für erforderlich erklärt, wenn der Patient den Wunsch, z.B. in Form einer Patientenverfügung, erklärt hat. (Vgl. Ankermann 2004, 82) Nur ein Viertel der behandelnden Ärzte lesen vorhandene Patientenverfügungen. Konkrete Anweisungen in der Verfügung wurden in 50% der Fälle nicht beachtet. Dann ordnet der Arzt Maßnahmen an, da er sie für richtig hält, obwohl dies dem Wunsch des Patienten widerspricht. (Vgl. Ankermann 2004, 96)
5.4 Die Sterbehilfe in den Niederlanden
Die Niederlande sind neben Belgien, der Schweiz und einige Bundesstaaten der USA eines der wenigen Länder weltweit, in denen es eine gesetzliche Regelung gibt, die bestimmt, wer unter welchen Umständen einem anderen Menschen straflos Sterbehilfe leisten darf. Die Niederlande werden hier als Beispiel dargestellt für ein Land, in dem es eine legale Form der aktiven Sterbehilfe gibt.
[...]
[1] Teilnehmer der Tagung, auf der die Einbecker Empfehlungen verabschiedet wurden, siehe hierzu Kapitel 3