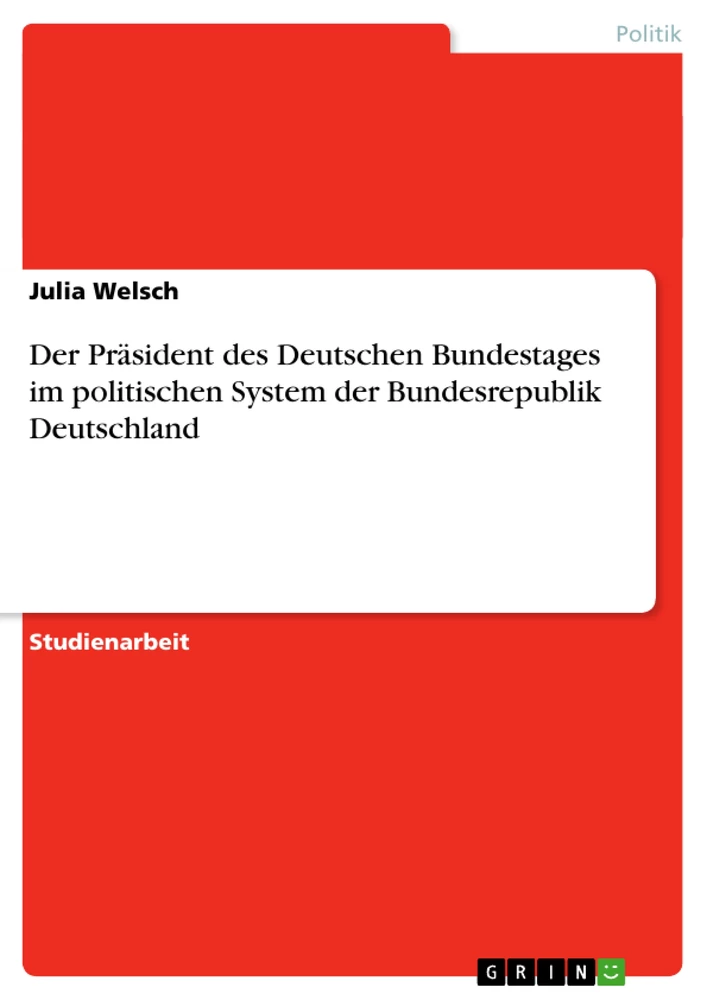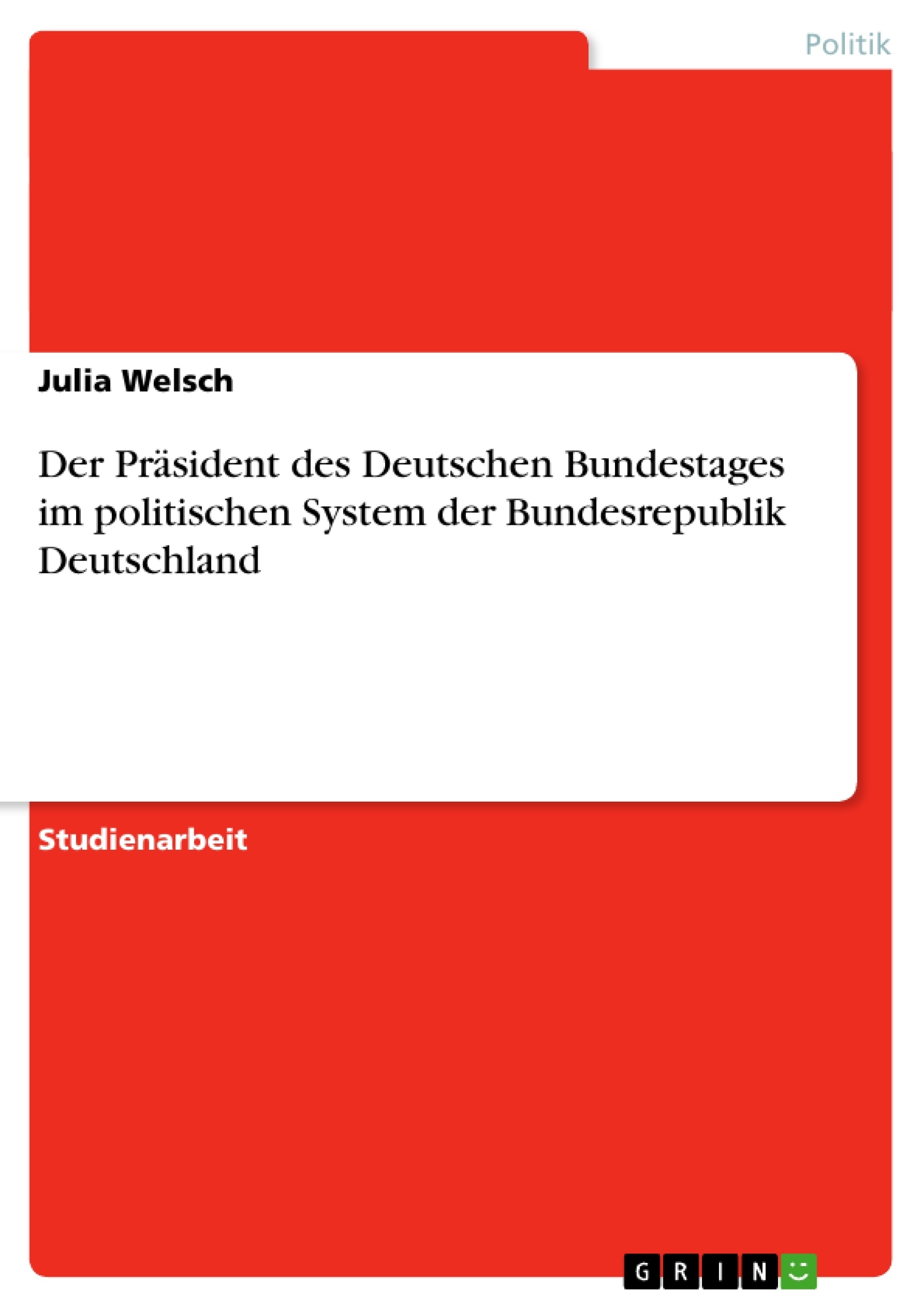„Die Bundesrepublik Deutschland“, so bestimmt Artikel 20 des Grundgesetzes, „ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtssprechung ausgeübt.“
In diesem so definierten Staat, der Bundesrepublik Deutschland, nimmt der Deutsche Bundestag die Stellung des obersten demokratischen Organs ein. Im Staatsaufbau wie auch bei der politischen Willensbildung spielt er eine zentrale Rolle.
Aus Abgeordneten zusammengesetzt, die als Vertreter des ganzen Volkes in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden (Artikel 38 Grundgesetz) verkörpert der Bundestag den Volkswillen, der durch die Wahl auf ihn übertragen wird. In dieser Übertragung drückt sich das Prinzip der repräsentativen Demokratie aus, das als beste Möglichkeit gilt, in einem viele Millionen Bürger zählenden Gemeinwesen dem Grundsatz von der Selbstbestimmung des Volks zu genügen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Entstehung des Amtes
3. Das Bundestagspräsidentenamt- das zweithöchste Amt in der Bundesrepublik Deutschland
4. Wahl des Bundestagspräsidenten
4.1 Verfahrensregeln
5. Abberufung des Bundestagspräsidenten
6. Hauptaufgaben
6.1 Repräsentant des Bundestages
6.2 Vorsitzender des Bundestages
6.3 Hausherr im Bundestag
6.4 Behördenchef
7. Entschädigung
8. Entscheidungen
8.1 „Ferrero- Spendenskandal“
8.2 „Freiflug- Affäre“
9. Nachwort
I. Anhang
II. Abbildungsverzeichnis
III. Literaturverzeichnis
IV. Onlinequellen
V. Erklärung
1. Einleitung
„Die Bundesrepublik Deutschland“, so bestimmt Artikel 20 des Grundgesetzes, „ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtssprechung ausgeübt.“
In diesem so definierten Staat, der Bundesrepublik Deutschland, nimmt der Deutsche Bundestag die Stellung des obersten demokratischen Organs ein. Im Staatsaufbau wie auch bei der politischen Willensbildung spielt er eine zentrale Rolle.
Aus Abgeordneten zusammengesetzt, die als Vertreter des ganzen Volkes in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden (Artikel 38 Grundgesetz) verkörpert der Bundestag den Volkswillen, der durch die Wahl auf ihn übertragen wird. In dieser Übertragung drückt sich das Prinzip der repräsentativen Demokratie aus, das als beste Möglichkeit gilt, in einem viele Millionen Bürger zählenden Gemeinwesen dem Grundsatz von der Selbstbestimmung des Volks zu genügen.
Ohne den Bundestag kann weder ein Gesetz beschlossen werden, noch der Bundeskanzler als Regierungschef bestellt werden. Zumal sich darin auch die konsequente parlamentarische Regierungsform ausdrückt, welche die Bundesrepublik Deutschland kennzeichnet. Ebenso ist der Bundestag an der Wahl des Staatsoberhauptes, des Bundespräsidenten, beteiligt.
Daraus ergibt sich für den Bundestag aus seiner Funktion als höchstes demokratisches Organ die Aufgabe, der Ort zu sein, an dem die vielen und oft sehr verschiedenen Meinungen und Wünsche, die Streitfragen und Probleme einer offenen Gesellschaft darstellt, diskutiert und ausgetragen werden. Er soll das oberste Organ für die politische Selbstdarstellung des Gemeinwesens oder, wie es oft heißt, das Forum der Nation sein.
Um diese Aufgabe wahrnehmen zu können, muss die Arbeit des Bundestages geleitet und kontrolliert werden. Dies geschieht durch den Präsidenten des Deutschen Bundestags. Das Amt des Bundestagspräsidenten gehört somit zu den angesehensten in der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundestagspräsident ist der staatsrechtliche Repräsentant des Bundestages. Trotz dieser wichtigen Aufgabe wird das Amt des Bundestagspräsidenten oftmals nur am Rande betrachtet.
Die vorliegende Hausarbeit will dem Leser dagegen einen zusammenhängenden Einblick in die Arbeit des Bundestagspräsidenten geben.
Ich werde deshalb in meinen folgenden Ausführungen auf die Geschichte des Bundestagspräsidentenamtes eingehen. Ausgehend von diesem kurzen Abriss, werde ich mich der Stellung des Bundestagspräsidenten in der Bundesrepublik Deutschland zuwenden.
In einem weiteren Teil werde ich auf die Wahl des Bundestagspräsidenten und auf die Amtszeit eingehen. Weiterhin werde ich die vier Hauptfunktionen des Bundestagspräsidenten beschreiben. Hierbei liegt mein Augenmerk auf der Funktion des Repräsentanten, des Vorsitzenden, der Aufgabe des Hausherrn und des Behördenchefs. Auch die Amtsentschädigung soll in dieser Arbeit beleuchtet werden.
Im letzten Abschnitt möchte ich auf zwei aktuelle Entscheidungen des Bundestagspräsidenten eingehen. Leider muss ich mich auf zwei Fälle beschränken, um den vorgegebenen Rahmen dieser Hausarbeit einhalten zu können.
Ziel dieser Arbeit soll sein, dass deutlich wird, dass der Präsident des Bundestages durch sein Wirken für das Ansehen unserer parlamentarischen Demokratie von großer Bedeutung ist.
2. Entstehung des Amtes
Die Entwicklung des Parlamentarismus, das Ringen um eine gesamtstaatliche Volksvertretung, wurde in den meisten Staaten Westeuropas zur beherrschenden politischen Frage. Es entstanden politische Bewegungen, es wurden Forderungen erhoben und Programme formuliert, deren Ziel es war, die nationalstaatliche Einigung auf der Grundlage einer freiheitlichen Verfassung in politische Wirklichkeit umzusetzen.
Im Verlauf dieser Entwicklung gab es europäische Gemeinsamkeiten, aber zugleich auch tief greifende nationale Unterschiede. Nur in England bildete sich früh ein gesamtstaatliches Parlament heraus, dass auf der Zusammenarbeit zwischen Krone und Parlament beruhte und in der Zusammensetzung seiner Häuser („House of Lords“ und „House of Commons“) die gesellschaftliche Entwicklung der Zeit weitgehend widerspiegelte.
Im 13. Jahrhundert entwickelte sich in England neben der Versammlung des hohen Adels, dem „House of Lords“ eine Vertretung der Städte und Grafschaften, dem „House of Commons“. Beide Häuser verwuchsen zu einem Parlament, welches die Rolle der Vertretung der gesamten Nation übernehmen sollte. Daraus folgte, dass der König und das Parlament die entscheidenden Faktoren der politischen Macht in England waren. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde das Politikbild England besonders durch den Konflikt zwischen diesen beiden politischen Mächten geprägt. „Zwar sprach schon der Staatssekretär Königin Elizabeths I. (1558- 1603) dem Parlament „die höchste und absolute Gewalt im Königreich“ zu, doch erst mit der „Declaration of Rights“ (1689) wurde die feste Grundlage des Parlamentarismus, die Suprematie des Parlaments geschaffen.“[1] Diese „Declaration of Rights“ wurde später in „Bill of Rights“ umbenannt und bildete den Schlusspunkt einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung zwischen Monarchie und Parlament, in der letzteres seine Interessen weitgehend durchsetzte. In dieser „Bill of Rights“ wurde unter anderem festgelegt, dass es freie Wahlen zum Parlament geben sollte. Weiterhin wurde auch die gesetzgeberische und kontrollierende Funktion des Parlaments im Staat festgehalten. Durch den weiter anhaltenden Kampf zwischen König und Parlament entwickelte sich das Amt des „Speakers“ des
Unterhauses. Dieser „Speaker“ war ursprünglich ein besoldeter Vertreter des Königs im Parlament, der die Interessen der Krone gegenüber dem Parlament zu vertreten hatte. Mit der zunehmenden Wahrnehmung der Rechte des Parlaments wuchsen die Ansprüche auf eine freie Wahl seines Vorsitzenden. „„Der „Speaker“ sollte der unbeeinflusste, unparteiische, politisch ungebundene Leiter der Versammlungen des Hauses sein, der sein Amt durch seinen Charakter und sein allgemeines Ansehen prägt, nicht durch politische Aktivität.“[2] Auf diesen Forderungen, baut bis Heute das Amt des „Speakers“ auf.
Die deutsche Geschichte stand nicht unter dem günstigen Stern solcher Kontinuität, da die Beharrungskraft des deutschen Partikularismus, also die politische und geistige Enge der deutschen Kleinstaaterei bewirkten, dass in Deutschland der freiheitliche Nationalstaatsgedanke erst verhältnismäßig spät in den Blickpunkt der Bürger rückte. In den Jahrzehnten zwischen 1815 und 1848, im so genannten „Vormärz“, entstand in Deutschland eine politische Opposition gegen das auf der Grundlage von Restauration, monarchischer Legitimität und fürstlicher Solidarität beruhenden Herrschaftssystem des Deutschen Bundes. Zum Höhepunkt des Vormärz wurde das „Hambacher Fest“ 1832. Dieses Fest geriet zu einer machtvollen Demonstration für eine politische Neuordnung, wie sie Deutschland in diesem Umfang noch nicht erlebt hatte. Das gemeinsame Hauptziel hieß „Einheit und Freiheit“, jedoch mit unterschiedlichen Vorstellungen über die zukünftige Staatsverfassung und über den Umfang wirtschaftlicher und sozialer Reformen. Der gemeinsame Wille der Bevölkerung, die politische Ordnung des Deutschen Bundes zu überwinden, führte zur März- Revolution von 1848. Der revolutionären Zielsetzung entsprach ein demokratisch ausgestattetes Wahlrecht. Am 18. Mai 1848 versammelten sich in der Paulskirche die Mitglieder des ersten, aus freien, allgemeinen und gleichen Wahlen hervorgegangenen gesamtdeutschen Parlaments. Ziel war es, eine auf Freiheit und größerer sozialer Gerechtigkeit beruhende Verfassung zu beraten und zu verabschieden und auf ihrer Grundlage den deutschen Nationalstaat zu begründen. Dieses Parlament war ähnlichen Schwierigkeiten ausgesetzt, wie das englische Parlament. Da der Einfluss der Monarchie sehr gewaltig war. Das Parlament benötigte deshalb einen „Sprecher“ der die Interessen der Nationalversammlung gegenüber dem König vertritt. Es entstand das Amt des Präsidenten der Nationalversammlung.
Dieses Amt wurde nach englischem Vorbild aufgebaut. Auch die Rechte und Pflichten dieses Amtes, als auch die Arbeitsweise glichen sehr dem englischen Vorbild des „Speakers“. Heinrich von Gagern wurde zum ersten Präsidenten der Nationalversammlung ernannt.
[...]
[1] Feldkamp, Michael F., Der Bundestagspräsident. Amt, Funktion, Personen, 16. Wahlperiode, 17. aktualisierte und überarbeitete Auflage, München 2007, S. 91.
[23] Feldkamp, Michael F., Der Bundestagspräsident. Amt, Funktion, Personen, 16. Wahlperiode,
17. aktualisierte und überarbeitete Auflage, München 2007, S. 92.