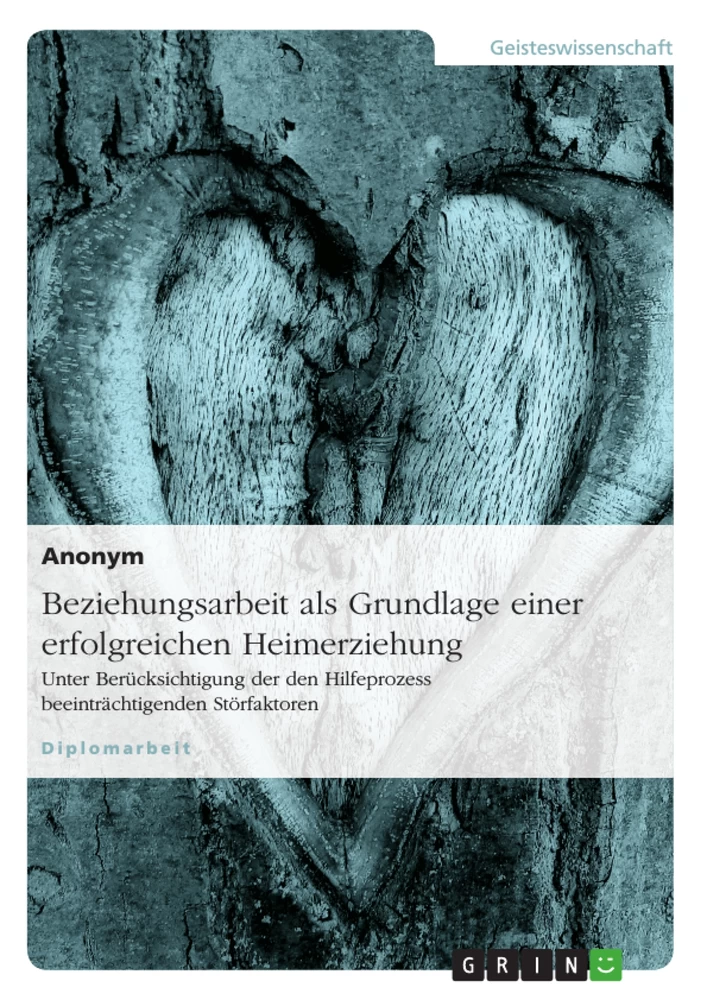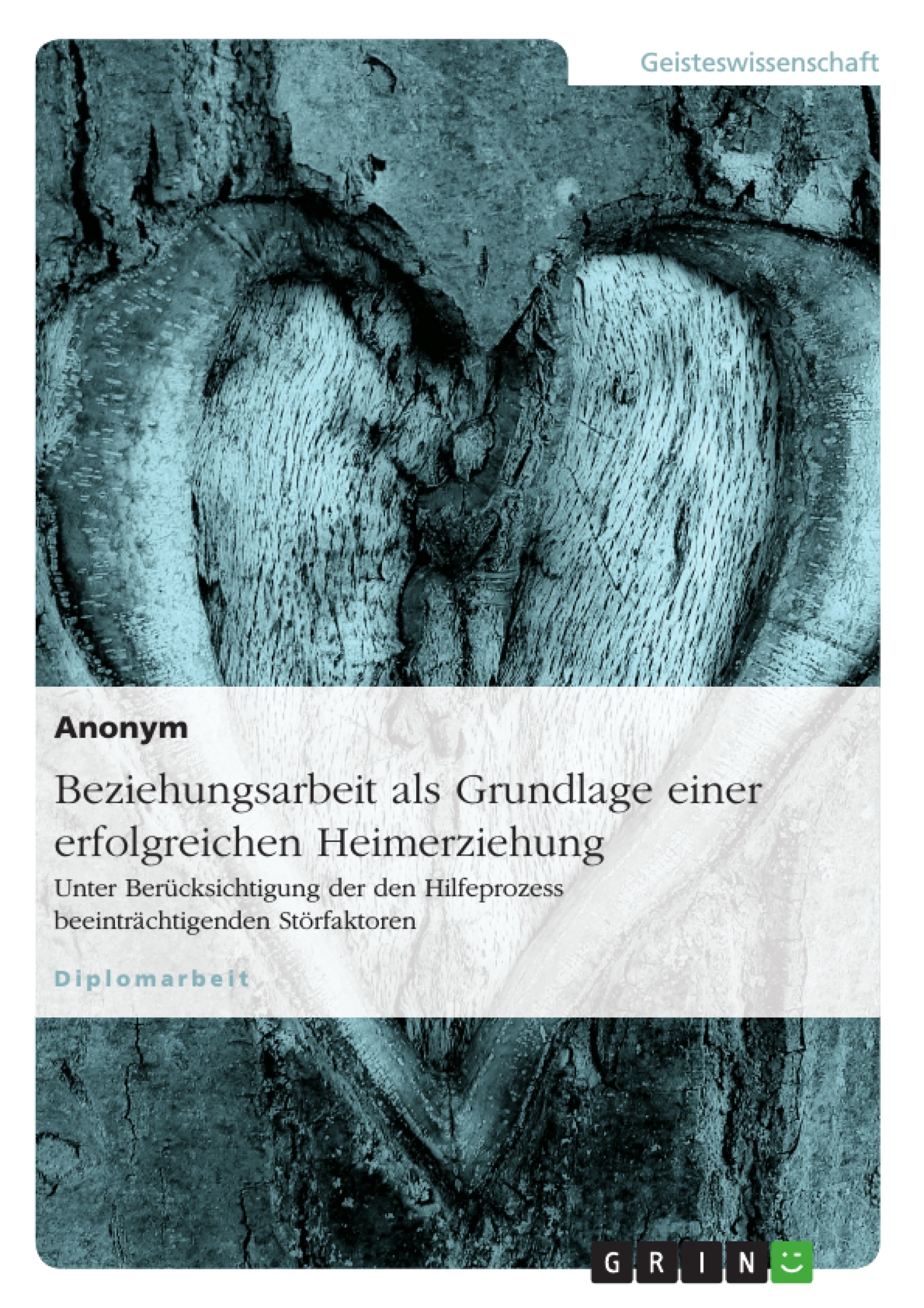[...] Es gibt jedoch Faktoren, welche einen erfolgreichen Hilfeprozess, der auf der Basis eines Beziehungsaufbaus beruht, negativ beeinträchtigen kann. Der Hilfeprozess ist meist von langer Dauer. Infolgedessen hat die Einrichtung für eine kontinuierliche Bereitstellung eines beständigen Fachpersonals zu sorgen. In Zeiten von Kosteneinsparungen kann dies jedoch nicht abgesichert werden. So können Arbeitszeitregelungen, Personalwechsel und befristete Arbeitsverträge zu einer Beeinträchtigung des Hilfeprozesses beitragen. Wie sich diese Störfaktoren auf das Personal und folglich die Klientel im Heim auswirken, ist unter anderem Thema der folgenden Seiten. Dabei wird nicht nur auf die Beziehungsarbeit geschaut, sondern auch die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter, denn hier muss unter anderem angesetzt werden. Der genaueren Betrachtung der aktuellen Probleme dient eine quantitative Befragung von 30 Mitarbeitern aus der (voll)stationären Erziehungshilfe. Ziel dieser Befragung ist es, aufzuzeigen, welchen Einfluss ein ständiger Personalwechsel auf die Beziehungsarbeit, welche Grundlage für die Zielerreichung und Aufgabenerfüllung der Heimerziehung ist, hat. Des Weiteren soll hier Das Verhältnis zwischen einem Kontakterzieher und seinem Kontaktkind erfasst werden und zum Abschluss rücken die Leistungsmotivation und Verbesserungsvorschläge der gegebenen Situation in den Mittelpunkt. Die Befragten sollen reflektieren und zum Nachdenken über die derzeitige Situation im Heim angeregt werden. Als Abschluss dieser Arbeit werden einige Lösungsansätze aufgezeigt, die eine Besserung der derzeitigen Situation aufzeigen sollen.
Inhaltsverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
I. Literaturauswahl
2. Das Verständnis von Beziehungen
2.1 Elternbotschaften von Beziehungen
2.2 Entwicklung von Bindungen
2.3 Die Gesellschaft in der Beziehungskrise
2.4 Bindungsstörungen
3. Die Heimerziehung
3.1 Strukturen des Heims
3.2 Klientel im Heim
3.3 Die Aufgaben der Sozialpädagogen im Heim
3.4 Nähe – Distanz- Verhältnis
3.4.1 Erwartungen an den Sozialpädagogen von Seiten der Eltern
3.4.2 Erwartungen an den Sozialpädagogen von Seiten der Klientel
4. Ziele und Aufgaben der Heimerziehung im Kontext des KJHG
4.1 Ergänzende Ziele und Aufgaben der Heimerziehung
4.2 Zielformulierung
5. Beziehungsaufbau in der Heimerziehung
5.1 Die Bedeutung eines guten Beziehungsaufbaus in der Heimerziehung
5.2 Der Beziehungsaufbau im Praxisbezug
6. Qualität als wichtiger Bestandteil der Heimerziehung
6.1 Qualität in der sozialen Arbeit
6.2 Gründe für die Qualitätsentwicklung in der Heimerziehung
6.3 Die drei Eckpunkte nach dem Kinder- und Jugendbericht
6.4 Personalwesen und interne Vernetzung
6.4.1 Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Heimerziehung
6.4.2 Qualität als Erfolgsmaßstab
7. Störfaktoren, die eine erfolgreiche Heimerziehung beeinträchtigen können
7.1 Befristete Arbeitverträge
7.1.1 Gründe für befristete Arbeitsverträge
7.1.2 Folgen von befristeten Arbeitsverträgen
7.2 Arbeitszeitregelungen nach dem Gesetz
7.2.1 Heimspezifische Schlussfolgerungen
7.2.2 Gründe für flexible Arbeitszeitregelungen
7.2.3 Praxisbezug
7.2.4 Folgen für die Mitarbeiter/innen und daraus entstehende
Schlussfolgerungen
7.3 Personalwechsel innerhalb (voll)stationärer Einrichtungen
7.3.1 Folgen des Personalwechsels für die Klientel
7.3.2 Folgen des Personalwechsels für die Mitarbeiter/innen
7.4 Motiv und Motivation
7.5 Erfolg im Blickwinkel der sozialen Arbeit
7.6 Körperliche Beschwerden der Mitarbeiter/innen
7.7 Absentismus und Personalfluktuation als generelle Folge
II. Empirischer Teil
8. Quantitative Befragung
8.1 Anlass, Ziele und Hypothesen der Befragung
8.1.1 Empirische Untersuchungsmethodik und Umfang der Befragung
8.1.2 Aufbau der Untersuchung
8.1.3 Problematik während der Untersuchung
8.1.4 Fragestellungen und Skalierung des Fragebogen
8.2. Ausführung und Auswertung
8.2.1 Erhebungsvorgehen
8.2.2 Auswertungsmethode
8.3 Darstellung und Interpretation
9. Lösungsansätze
10. Schlusswort und Reflexion
Anhang
Fragebogen
Auswertung des Fragebogens
Literaturverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Tabellen:
Tabelle1: Überblick über tariflich angestellte oder befristet angestellte Mitarbeiter
Tabelle 2: Die Reaktion der Mitarbeiter auf den ständigen Personalwechsel
Tabelle 3: Verhaltensänderung der Kinder durch den ständigen Personalwechsel
Tabelle 4: Einfluss des Personalwechsels auf das Beziehungsverhalten der Klientel
Tabelle 5: Leistungsmotivierende Faktoren
Abbildungen:
Abbildung 1: Haupterklärungsvariablen
Abbildung 2: Ein Wunsch zu wechseln oder eine Handlung nach Anweisung?
Abbildung 3: Anzahl der Personalwechsel
Abbildung 4: Zeitraum der Eingewöhnung
Abbildung 5: Reaktion der Mitarbeiter auf den ständigen Personalwechsel
Abbildung 6: Verhaltensäußerung bei den Kindern
Abbildung 7: Folgen für die Beziehungsarbeit
Abbildung 8: Leistungsmotivierende Faktoren
1. Einleitung
„Das Handeln orientiert sich nicht am Jetzt, sondern an seiner Wirkung in Zukunft“ (Lindenmeyer, H. 2003, S. 10). Dieses Zitat spiegelt die Realität wieder, in der wir uns befinden, nur oft verschließen die Menschen die Augen vor der Wirkung. Gerade die Bindungs- und Beziehungserfahrungen, die Kinder in ihrem Elternhaus erhalten sind ein gutes Beispiel für das Zitat von Lindenmeyer, denn die gesammelten Erfahrungen prägen die Kinder für ihr späteres Leben. Beziehungen sind für jedes Individuum sehr wichtig, da mit ihnen unterschiedlichste Erfahrungen gesammelt und erlernt werden können, um sich in die Gesellschaft zu integrieren. Schon in der frühsten Kindheit wird über die Zukunft der Kinder entschieden. Die Qualität der frühen Bindungsbeziehungen entscheidet über die spätere Beziehungsfähigkeit bis in das Erwachsenenalter hinein. Die wichtigsten Erfahrungen sind die der zwischenmenschlichen Beziehungen zum Umfeld sowie die Bindungserfahrungen, die erlebt werden. Hieraus entwickelt sich ein eigenes Verständnis. Die Heranwachsenden lernen am Vorgelebten der Eltern. Es ist das Modelllernen, dass die Grundlage für das spätere Zurechtkommen in der Gesellschaft bildet. Voraussetzung dafür ist die Fähigkeit, Beziehungen einzugehen und offen auf andere zugehen zu können. Dazu ist es wichtig zu verstehen, was Beziehungen überhaupt sind. Jedoch ist zu bedenken, dass nicht alle Kinder in einem behüteten Elternhaus aufwachsen, welches positive Bindungserfahrungen gewährleistet. Die Folgen einer gescheiterten Bindung und die Auswirkungen auf einen Beziehungsaufbau zu seinen Mitmenschen sollen im Anschluss geklärt werden.
Nach Artikel 6 (2) des Grundgesetzes heißt es: „ Die Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“ (Stascheit, U. 2005, S.4). Über diese Erfüllung der Pflicht wacht die staatliche Gemeinschaft. (vgl. Stascheit, U. 2005, S.4).
Wenn diese Erziehung und Versorgung aus verschiedenen Gründen scheitert, hat der Staat das Recht einzugreifen. Hierbei wird versucht den Eltern eine Unterstützung zukommen zu lassen, indem verschiedene Hilfsangebote unterbreitet werden. Eine Institution, in der Hilfen erbracht werden können, ist die Heimunterbringung. Diese Hilfsform wird im Folgenden näher beschrieben. Um ein klares Verständnis zum Begriff der Heimerziehung zu erhalten, wird näher auf die Klientel im Heim, die Aufgaben der Sozialpädagogen im Heim und die Erwartungen aller Beteiligten eingegangen. Dabei ist die Erreichung der Aufgaben und Ziele der Heimerziehung sehr wichtig und wird aus diesem Grund erklärt. Um diese Aufgaben und Ziele jedoch zu erreichen und somit einen Erfolg herbeizuführen, muss an der Grundlage jeglichen Handelns gearbeitet werden. Dabei ist der Beziehungsaufbau zum Klienten (Kinder und Jugendliche, die Hilfen erhalten) gemeint. „ Schließlich hängt der Erfolg einer solchen Erziehungshilfemaßnahme entscheidend von der Qualität der pädagogischen Beziehung ab […]“ (Schleiffer, 2007, S.7). Nur durch die Schaffung einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage, auf der das professionelle Handeln basiert, können die Ziele der Heimerziehung erfolgreich erarbeitet und erreicht werden. Der Beziehungsaspekt spielt dabei die wichtigste Rolle, da ohne einen Beziehungsaufbau, der sich auf das gegenseitige Vertrauen zwischen der sozialpädagogischen Fachkraft und dem Klienten stützt, kein gemeinsames Arbeiten möglich ist. Die Heimerziehung ist zudem als vielschichtig zu betrachten. Dabei findet nicht nur eine intentionale Beziehung zwischen dem Pädagogen und dem Klienten statt, sondern auch die gesetzlichen und behördlichen Aufträge, die zu erfüllen sind. Das Personal der Heimerziehung handelt dementsprechend nicht nur im Auftrag der Klienten, sondern hat auch eine Verantwortung gegenüber dem Gesetz und der Behörde. Aus diesem Grund sollten alle Maßnahmen, die eine positive Veränderung beim Klienten herbeiführen sollen, mit den Auftraggebern besprochen werden. Hierzu ist eine gute Kooperation untereinander wichtig. Dabei wird auch immer wieder ein Augenmerk auf die Qualität innerhalb der Einrichtungen gelegt. Da der Aspekt der Heimerziehung eine Hilfsform ist, die immer mehr an Bedeutung gewinnt und oft als Maßnahme, Hilfe zu gewähren, gewählt wird, ist eine regelmäßige Kontrolle und Reflexion durchzuführen. Das heißt, es muss in allen Einrichtungen geschaut werden, inwieweit die Aufgaben und Ziele erreicht werden können und an welchen Stellen es Probleme gibt. Daraus kann man Schlussfolgerungen ziehen und Verbesserungsmöglichkeiten in Betracht ziehen. Heutzutage wird dieser Weg noch zu selten eingeschlagen. Die Probleme werden meist erst erkannt, wenn es zu spät ist. Im Mittelpunkt steht das Wohl der Kinder und der Jugendlichen, die sich im Heim befinden. Um entscheiden zu können, welche Ziele und Aufgaben dafür erfüllt werden müssen, ist das pädagogische Fachpersonal die wichtigste Ressource im Hilfeprozess. Da die Kinder und Jugendlichen die meiste Zeit während der Hilfsmaßnahmen mit den Fachkräften verbringen, ist beim Fachpersonal anzusetzen. Sie sollten als Ansprechpartner gesehen werden. Deshalb ist ein gutes Verhältnis bzw. Beziehungsaufbau zwischen Fachkraft und Klienten ausschlaggebend. Es gibt jedoch Faktoren, welche einen erfolgreichen Hilfeprozess, der auf der Basis eines Beziehungsaufbaus beruht, negativ beeinträchtigen kann. Der Hilfeprozess ist meist von langer Dauer. Infolgedessen hat die Einrichtung für eine kontinuierliche Bereitstellung eines beständigen Fachpersonals zu sorgen. In Zeiten von Kosteneinsparungen kann dies jedoch nicht abgesichert werden. So tragen Arbeitszeitregelungen, Personalwechsel und befristete Arbeitsverträge zu einer Beeinträchtigung des Hilfeprozesses bei. Wie sich diese Störfaktoren auf das Personal und folglich die Klientel im Heim auswirken, ist unter anderem Thema der folgenden Seiten. Dabei wird nicht nur auf die Beziehungsarbeit geschaut, sondern auch die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter, denn hier muss unter anderem angesetzt werden. Der genaueren Betrachtung der aktuellen Probleme dient eine quantitative Befragung von 30 Mitarbeitern aus der (voll)stationären Erziehungshilfe. Ziel dieser Befragung ist es, aufzuzeigen, welchen Einfluss ein ständiger Personalwechsel auf die Beziehungsarbeit, welche Grundlage für die Zielerreichung und Aufgabenerfüllung der Heimerziehung ist, hat. Des Weiteren soll hier Das Verhältnis zwischen einem Kontakterzieher und seinem Kontaktkind erfasst werden und zum Abschluss rücken die Leistungsmotivation und Verbesserungsvorschläge der gegebenen Situation in den Mittelpunkt. Die Befragten sollen reflektieren und zum Nachdenken über die derzeitige Situation im Heim angeregt werden. Als Abschluss dieser Arbeit werden einige Lösungsansätze aufgezeigt, die eine Besserung der derzeitigen Situation aufzeigen sollen.
I. Literaturauswahl
2. Das Verständnis von Beziehungen
Da der Mensch sehr viel Zeit seines Lebens in Gesellschaft anderer lebt, ist kaum zu vermeiden, dass er dabei eine sehr große Anzahl von Beziehungen unterschiedlicher Dauer und Intensität eingeht.
„Für fast jeden von uns bilden Beziehungen zu anderen Menschen den wichtigsten Teil unseres Lebens“ (Auhagen & Salisch, 1993, S.7). So wird die frühkindliche Entwicklung wesentlich durch eine gute Beziehung zu einer Bezugsperson bestimmt. Hiernach prägen die Beziehungen zu Familienmitgliedern, Altersgenossen und Lehrern die Entwicklung der Persönlichkeit. (vgl. Auhagen & Salisch, 1993, S.7) Die humanistische Psychologie betont, dass die Persönlichkeitsentwicklung und das Entstehen von Wertgefühlen nicht zuletzt durch die Begegnung mit anderen geschehen. Allgemein formuliert ist Beziehung deshalb eine Verbindung, ein Verhältnis zwischen zwei Subjekten, die sich in unterschiedlichen Kommunikationsformen äußern können. Vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen spielen hier eine wesentliche Rolle, da sie konstitutiv für das Leben des Menschen als soziales Wesen ausschlaggebend und prägend sind. Rogers ist der Meinung, dass die Bedingungen für eine gelingende Beziehung in der Echtheit, im einfühlenden Verstehen und in der emotionalen Wertschätzung liegen. Beziehung meint also, man bezieht sich hierbei aufeinander. (vgl. Frielingsdorf, 1999, S. 25) Grundlage dafür, dass ein Mensch beziehungsfähig ist und wie er mit anderen in Beziehung steht, ist meist das Bindungsverhältnis und die Erziehung in der Kindheit. So entwickeln Säuglinge nach der Geburt den Drang danach, beschützt und versorgt zu werden. „Ein funktionierendes Netz persönlicher Beziehungen bietet einen grundlegenden Schutz gegen Gefährdungen der psychischen und physischen Gesundheit“ (Auhagen & Salisch, 1993, S.7).
2.1 Elternbotschaften von Beziehungen
„Der Mensch lebt von der Zeugung an in Beziehungen und ist vor allem in den ersten Lebensjahren auf die Beziehung zu den primären Bezugspersonen angewiesen“ (Frielingsdorf, 1999, S. 59). Er benötigt somit viele Jahre diese Bezugspersonen (erfahrungsgemäß die Eltern), bis er selbstständig leben und neue Beziehungen partnerschaftlich gestalten kann. Dabei spielt die Familie als wichtigste Sozialisationsinstanz eine große Rolle. Die Familie hat die Chance wie keine andere Institution, die Persönlichkeit des heranwachsenden Menschen zu formen. Die hier geprägten Persönlichkeitsmerkmale sind in Zukunft nur noch schwer veränderbar.
Nach Goldstein, Freud und Solnit ist die Familie diejenige Umwelt, die am besten die körperlichen und seelischen Bedürfnisse des Kindes auf Dauer befriedigen kann. Kinder haben Bedürfnisse nach Ernährung, Versorgung, Gesundheit, nach Schutz und nach Wissen. Gleichermaßen benötigen sie stabile Bindungen, Liebe, Akzeptanz und Zuwendung. Diese zentralen Bedürfnisse kann die Familie in den ersten Jahren am besten befriedigen. (vgl. Kern, 2006, Vorlesungsskript o. S.) Hierbei stellen die Eltern einen wichtigen Faktor dar, denn zwischen den Eltern und dem Kind entwickeln sich die ersten Bindungen. Vor allem in den ersten Lebensjahren soll durch das bindungsfördernde Elternverhalten eine positive emotionale Beziehungsgrundlage für die weitere kindliche Entwicklung geschaffen werden. Dabei ist auf einige Faktoren Rücksicht zu nehmen. Eine Fülle verschiedenster Einflüsse kann sich auf die Qualität des elterlichen Interaktion-Verhaltens auswirken. Hierbei ist die Rede von kindlichen Temperamentsmerkmalen, Armut wegen Arbeitslosigkeit und anderen Störfaktoren. Diese haben eine belastende Wirkung auf die Elternpersönlichkeit, die sich meist auf die Kinder auswirken. Selbst frühe Eltern - Kind - Beziehungen, die auf eine sichere Bindung hinweisen, sind kein Garant dafür, dass diese sichere Bindungsorientierung ein Leben lang anhält. (vgl. Oerter & Montada, 2002, S.119) Eltern übernehmen jedoch nicht nur die Rolle als Interaktionspartner, sondern sie sind auch gleichermaßen Erzieher. Hierbei wirken sie eindringlich auf ihre Kinder ein. Sie versuchen ihr Kind auf das wahre Leben vorzubereiten und sind ihnen dabei behilflich. Sie wollen ihre Kinder meist zu eigenständigen Personen erziehen. Ob dies gelingt, hängt vom Erziehungsstil der Eltern ab.
Nach Maccoby und Martin gibt es vier Erziehungsstile, die sich unterschiedlich auf die Kinder auswirken können. Zum einen gibt es den autoritären Erziehungsstil, bei dem die Eltern zurückweisend sind und starke Macht auf ihr Kind ausüben. Der vernachlässigende Erziehungsstil gibt dem Kind wenig Orientierung und der permissive Erziehungsstil gibt dem Kind ein Gefühl von Akzeptanz und fordert wenig. Der vierte Erziehungsstil ist autoritativ, und zeigt klare Strukturen auf, um ein Gefühl von Akzeptanz zu vermitteln. (vgl. Maccoby & Martin (1983) in Oerter, & Montada, 2002, S.119) Diese unterschiedlichen Erziehungsstile wirken sich demzufolge auf die Kinder aus und prägen sie. So konnten Schneewind und Ruppert nachweisen, dass die Erziehungsstile, die junge Erwachsene in ihrem Elternhaus erfahren haben, Einfluss auf ihre eigenen Erziehungspraktiken haben. (vgl. Schneewind und Ruppert in Oerter & Montada, 2002, S.124)
2.2 Entwicklung von Bindungen
In der Gesellschaft ist allgemein bekannt, dass Eltern für die Pflege, Versorgung, Betreuung und Erziehung ihrer Kinder verantwortlich sind. Dies umfasst zumindest den Zeitraum, indem Kinder nicht selbstständig für sich sorgen können. (vgl. Oerter & Montada, 2002, S.117)
Hierbei ist der normale Entwicklungsprozess eines Kindes gemeint, da es Kinder gibt, die ein Leben lang versorgungs- und gefühlsmäßig Kinder ihrer Eltern bleiben. Wie schon erwähnt, sind die Eltern in erster Linie für ihre Kinder Interaktionspartner. Durch die Art und Weise, wie Eltern auf ihre Kinder eingehen und mit ihnen umgehen, können sie schon früh Einfluss auf die Qualität kindlicher Bindungserfahrungen nehmen, in denen wechselseitige Beziehungsmuster zwischen den Eltern und dem Kind erkennbar werden. Eine Reihe von Eigenschaften des elterlichen Interaktionsverhaltens kann die erfolgreiche Etablierung einer sicheren Bindung des Kindes an seine Bezugsperson (meist die Eltern) bewirken. Nach De Wolff und van Ijzendoorn gehören dazu: Sensitivität für kindliche Signale, positive Haltung gegenüber dem Kind, Synchronisation im Sinne einer sanften Abstimmung wechselseitiger Interaktionen mit dem Kind, Unterstützung und Stimulation durch häufige Interaktionsaufnahme mit dem Kind. Diese Eigenschaften können in der Entwicklung des Kindes zu affektiven Bindungen zwischen den Eltern und dem Kind führen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit führen sie dazu, dass die Kinder als sicher gebunden eingeschätzt werden können. (vgl. De Wolff & Ijzendoorn in Oerter & Montada, 2002, S.117)
Dieses so genannte affektive Band soll dem Säugling Schutz vor lebensbedrohlichen Beeinträchtigungen bieten, denn in diesem Alter ist er nicht fähig selbst zu handeln und kann dementsprechend die Beeinträchtigungen nicht allein bewältigen. Des Weiteren soll das Band dazu dienen, den Säugling und später das Kleinkind auf die Welt neugierig zu machen und es dazu befähigen, die Welt zu erkunden und Erfahrungen zu sammeln. Somit besteht einerseits das Bedürfnis nach Bezogenheit auf die Eltern und zum anderen das Bedürfnis nach Autonomie. (vgl. Oerter & Montada, 2002, S.117f.)
Nach Bowlby entwickelt das Kind ein Bindungsverhaltenssystem, welches aus der Evolution stammt und das Überleben einer Spezies sichert. Danach bildet jedes Kind im Laufe des 1. Lebensjahres eine personenspezifische Bindung aus. Bowlby meint, dass eine Bindung ein psychologisches Konstrukt ist, das Emotionen, Motivationen und Verhalten des Kindes je nach den Erfordernissen der Situation strukturiert. Somit wird in sicheren Situationen kein Bindungsverhalten aktiviert. In unvertrauten Situationen bzw. Unwohlsein des Kindes wird die Bindung jedoch aktiviert. Hierbei sucht das Kind die Bindungsperson, die es jetzt beschützen soll. Bindungen werden aus der Gesamtheit von Verhaltensweisen in einer Situation erschlossen, die dazu dienen, die Nähe zur Bindungsperson herzustellen und ihren Schutz zu erhalten. Diese Bindung vollzieht sich in vier Phasen, die hier nur kurz erwähnt werden. Die erste Phase wird als so genannte Vorphase bezeichnet, in der das Kind noch nicht an spezifische Personen gebunden ist. Hierbei unterscheidet es nicht zwischen den Personen, sondern reagiert auf Signale. Die darauf folgende Phase beinhaltet die Differenzierung zwischen Personen und die dementsprechende Reaktion auf die verschiedenen Personen. Die eigentliche Bindung erfolgt aber erst in der dritten Phase, in der das Kind seine motorischen und kognitiven Fähigkeiten besonders entwickelt. Das Kind ist bereit, Personen zu unterscheiden und sie dementsprechend zu vermissen. Die vierte Phase erreicht das Kind erst im dritten Lebensjahr. Es ist die Phase der zielkorrigierten Partnerschaft. Wichtig für Kinder, die Bindungen aufbauen, ist es, eine kontinuierliche Bindung zu bestimmten Personen zu haben. Daher ist es unerlässlich, dass sie Liebe, Akzeptanz und Zuwendung erhalten. Stabile Bindungen sind hier vordergründig zu betrachten. Die Bedürfnisse der Kinder sollten dabei im Mittelpunkt stehen und somit in diese einbezogen werden. Durch Geborgenheit, beständiges Interesse auf Seiten der Eltern, Schaffung von Urvertrauen und anderen Bedingungen werden stabile Bindungen manifestiert und dies ermöglicht es den Kindern, diese stabilen Bindungen eventuell auf Dauer zu erhalten und weiterzugeben. (vgl. Oerter, & Montada, 2002, S. 197) Gegenwärtig ist dieser Bindungsaufbau jedoch stark gefährdet, da sich eine neue Form von gesellschaftlichem Denken ohne Struktur und Disziplin entwickelt.
2.3 Die Gesellschaft in der Beziehungskrise
Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Beziehungsgefüge in den Familien und Sozialstrukturen relativ überschaubar und zuverlässig. Jedoch vollzog sich im Laufe der letzten Jahre eine Art Auflösung dieser Strukturen.
Viele der Werte, die unsere Gesellschaft zusammengehalten haben, bedeuten jungen Eltern nur noch wenig oder nichts mehr. Die Folgen dieses Werteverlustes können in der Öffentlichkeit, im Kindergarten und in der Schule betrachtet werden. (vgl. Post, 2002,S.77)
So befindet sich die heutige Gesellschaft in einer Art Beziehungskrise, in der sich viele fragen: „Zu wem gehöre ich? An wen kann ich mich wenden? Auf wen kann ich mich verlassen?“ Hinzu kommt, dass die Antworten auf diese Grundfragen des Vertrauens, der Beziehung- und Bindungsfähigkeit oft ausbleiben. Das heißt, dass Kinder zum Beispiel heute immer häufiger ohne feste Bindungen an Vater und Mutter aufwachsen. Dies geschieht meist, wenn die Eltern getrennt leben, geschieden sind, der Vater sogar unbekannt bleibt. Meist bleibt den Kindern keine Zeit die Situation zu verarbeiten. Sie werden mehrfach dazu animiert, ihre Gefühle zu unterdrücken. Somit erlebt das Kind oft ein Beziehungsgeflecht, dem es ohnmächtig ausgeliefert ist. Es reagiert je nach Persönlichkeit mit Rückzug, Trotz, Wut oder Lähmung.
Vor allem in konflikthaften Elternbeziehungen übernehmen die Kinder die Verhaltensweisen der Eltern durch das Modell - Lernen. Gerade die vorgelebten Formen verbaler oder körperlicher Auseinandersetzungen werden in das Verhaltensrepertoire des Kindes übernommen. (vgl. Oerter & Montada, 2002, S.124)
Da sich Beziehungen vor allem auf der emotionalen Ebene abspielen, sind in solchen Lebensgeschichten die Probleme mit Nähe und Distanz von Beziehungen vorprogrammiert. Das heißt, einerseits besteht ein großes Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit, da dies in der Kindheit fehlte. Andererseits versuchen die Betroffenen wenig Nähe zu anderen zuzulassen und intime Beziehungen einzugehen, aufgrund der schlechten Erfahrungen in der Kindheit.
(vgl. Frielingsdorf, 1999, S. 59f.)
Angesichts dieser vielfältigen Bindungsprobleme und Beziehungsstörungen ist es notwendig, sich mit den in der Familie gelernten Beziehungsmustern bewusst auseinander zu setzen.
2.4 Bindungsstörungen
Wenn keine sicheren Bindungen in der Kindheit aufgebaut werden konnten, kann es zu Bindungsstörungen kommen. Oft ist ein unzweckmäßiges Verhalten der Bezugspersonen eine Mitursache für Störungen im Sozialverhalten der Kinder. Gerade inkonsequentes Erziehungsverhalten, das zwischen Nachgeben und schroffen, unfreundlichen Zurückweisen schwankt, können Ursachen solcher Störungen sein (Erziehungsstile). Im Normalfall sollten die Bezugspersonen ihr Kind beim Aufbau bestimmter Verhaltenweisen erzieherisch unterstützen. Durch das Fehlen sozialer Bindungen, mangelt es den Kindern oft daran, Beziehungen aufzunehmen. Aus Erkenntnissen, die mit der Zeit gesammelt wurden, geht man davon aus, dass das Störungsbild eine Folge elterlicher Vernachlässigung höheren Ausmaßes, von Missbrauch oder schwerer Misshandlungen sind. (vgl. Oerter & Montada, 2002, S.728f.)
„Die Kinder zeigen ein abnormes Beziehungsmuster, das durch eine Kombination von Annäherung und Vermeidung bzw. Widerstand gegen freundlichen Zuspruch gekennzeichnet ist“ (Oerter & Montada, 2002, S.729). Aus diesem Grund sind sie meist ängstlich, übervorsichtig, haben geringe soziale Kontakte zu Gleichaltrigen und neigen zu Selbstaggressionen und Unglücklichsein. (vgl. Oerter & Montada, 2002, S.729)
Brennan und Shaver fanden nach Untersuchungen heraus, dass Kinder aus Scheidungsfamilien eher einen unsicheren - ängstlichen Bindungsstil entwickeln, jedoch Halbwaisen einen mehr abweisenden Bindungsstil aufweisen. (vgl. Brennan und Shaver in Oerter & Montada, 2002, S.831)
Gerade Scheidungsfamilien, Familien die in großer Armut leben, oder auch Familien, in der das Wohl des Kindes durch ein Elternteil gefährdet ist, sind Gemeinschaften, die mit ihren Kindern bzw. der problematischen Situation überfordert sind. Aus diesen Situationen ergeben sich Probleme für die Kinder, da ihre Grundbedürfnisse (Nahrung, Gesundheit, Erfahrungen sammeln, Liebe und Zuwendung) meist nicht mehr gedeckt werden können. Somit ist auch die Sozialisation des Individuums gefährdet. „Sozialisation ist der gesellschaftlich vermittelte Lernprozess, durch den die Menschen individuell und kollektiv in einem bestimmten sozialen System sich orientieren und tätig werden“ (Freigang, 1986, S.18).
Die Familie stellt hierbei die wichtigste Sozialisationsinstanz dar. Gerade bei den oben benannten defizitären Familiensituationen kann es zu einer misslungenen Sozialisation kommen. Diese Sozialisationsprobleme äußern sich meist in starken Verhaltensstörungen der Kinder und können später zu abweichenden Verhalten führen.
Hierbei sind erste Anzeichen Verstörtheit in der Aufmerksamkeit, Kontaktstörungen, Lernschwierigkeiten und Lieblosigkeit der Kinder. (vgl. Witterstätter, 2002, S.113)
Wegen dieses schon erwähnten Wandels von einer überschaubaren stabilen Gesellschaft zu einer Gesellschaft, die sich in einer Beziehungskrise befindet, müssen verschiedene Hilfsangebote ermöglicht werden. Insofern hat sich die Zahl familiärer Hilfsansätze vermehrt und differenziert. Gerade wenn das Herkunfts- und Familienklima durch Interesselosigkeit, Lieblosigkeit oder zu großer Strenge gestört ist, sollte nach Lösungen gesucht werden, die zu einer Veränderung der Situation führen kann. Auch bei Armut und fehlenden familiären Ressourcen wird dem Kind oft eine normale Entwicklung erschwert.
Eine Möglichkeit, dem Kind und seiner Familie zu helfen, besteht in der Heimerziehung.
3. Die Heimerziehung
Mit der Heimerziehung ist jenes Arbeitsfeld gemeint, in dem Kinder und Jugendliche in Institutionen der Jugendhilfe stationär mittel- bis längerfristig leben, weil sie aus den verschiedensten Gründen nicht in ihrer Herkunftsfamilie angemessen aufwachsen und erzogen werden können. (vgl. Günder, 1989, S.14) Man kann die Heimerziehung auch als (voll)stationäre Erziehungshilfe bzw. Jugendhilfe bezeichnen. Im KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) ist die Heimerziehung eine der „Hilfen zur Erziehung“, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Das KJHG ist ein familienorientiertes Gesetz, in dem darauf verzichtet wird, der Jugendhilfe einen eigenen Erziehungsauftrag zuzugestehen. Das Prinzip ist, dass die Träger und Nutzer als gleichberechtigte Partner eine Aufgabe durch gemeinsames Bemühen zu lösen versuchen. Die Einrichtungen der Jugendhilfe sind in dem Fall das Jugendamt sowie zahlreiche freie Trägerschaften. Hierbei hat die Jugendhilfe die Aufgabe, die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag zu unterstützen und durch das Bereitstellen von verschiedenen Angeboten zu ergänzen. Das oberste Ziel ist es, Kinder und Jugendliche so zu begleiten, dass sie als Erwachsene in der Lage sind, ein selbstständiges und in der sozialen Gemeinschaft verankertes Leben zu führen. Die Hilfe wird dann als notwendig gesehen, wenn Eltern ihrer Funktion als Erziehende das „Wohl des Kindes“ (§ 27 KJHG) nicht gewährleisten können. (vgl. Hofer, Wild, & Noack, 2002, S.61)
Somit zielen die „Hilfen zu Erziehung“ darauf ab, dass:
-“…die Entwicklung (im Sinne von Reifung) eines jungen Menschen so begleitet wird, dass sie als gesellschaftlich angemessen einzuschätzen ist bzw. nach entwicklungs-psychologischen Erkenntnissen reflektiert wird;
- die Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten gestärkt wird und gegebenenfalls die Rahmenbedingungen so verbessert werden, dass die Erziehungskraft, also die Beziehungsfähigkeit gestärkt und dauerhaft stabilisiert wird;
- die Bewältigung des Alltags gefördert und stabilisiert wird;
- durch besondere Angebote verfestigte, gesellschaftlich und negativ bewertete Verhaltensmuster durchbrochen und neue objektiv wie subjektiv befriedigende Lebenskonzepte erprobt werden;
- durch ein `zweites Zuhause` eine emotionale Entlastung und Stabilisierung des ganzen Familiensystems erreicht wird;
- neue `psychologische Eltern` oder ein neuer mittelfristiger Lebensort gesucht werden“ (Günder, 20002, S.38f.)
Der Anspruch auf Hilfe liegt hier bei den Personensorgeberechtigten und die Art sowie der Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. (vgl. Ebeling, 2004, S. 11)
In unserem Fall spielt die Heimerziehung eine Rolle und soll uns somit als „Hilfe zur Erziehung“ dienen. Bevor jedoch ein Kind oder ein Jugendlicher in ein Heim kommt, werden alle anderen möglichen Hilfsangebote mit in Betracht gezogen und individuell auf den Klienten abgestimmt. Sind jedoch bestimmte Umstände gegeben, versucht man mit Hilfe der Heimerziehung zu agieren.
3.1 Strukturen des Heims
„Das Heim bietet dem Kind oder Jugendlichen im Unterschied zur Familie ein künstlich gestaltetes Lebensmilieu, welches unter dem Gesichtspunkt, eine möglichst nachhaltige Verhaltenskorrektur zu erzielen, pädagogisch-ökologisch arrangiert wurde. Bereits die räumliche Gestaltung der Gruppe, das Mobiliar, die Farbgebung spielen ebenso eine bedeutende Rolle wie die Einbettung der Gruppe bzw. Einrichtung in die Nachbarschaft und den Sozialraum, die Gruppengröße, der Betreuungsschlüssel, Einzel- oder Doppelzimmer usw. Dies alles sind Strukturmerkmale, die entscheidenden Einfluss darauf haben, ob sich ein Kind bzw. Jugendlicher in seiner neuen Umgebung wohlfühlen kann und die ihm dort entgegengebrachten Hilfsangebote annimmt. Von nicht minderer Bedeutung sind die in der Gruppe geltenden Regeln bzgl. Beurlaubung, Ausgang, Taschengeld usw., die Möglichkeit, an ihrer Gestaltung zu partizipieren, schließlich auch die Freizeitangebote in einer Gruppe, der Tagesablauf und nicht zuletzt die pädagogischen Fachkräfte selber, ihre Art, mit den Kindern und Jugendlichen umzugehen, ihre Bereitschaft, sich um deren Probleme zu kümmern und auf sie einzugehen. Viele Heime unterhalten Fachdienste, die durch Spieltherapie, psychomotorische Übungsbehandlung, Reittherapie, heilpädagogisches Werken und/oder Logopädie sehr gezielt auf besondere psychosoziale Problemstellungen von Kindern reagieren“ (Becker-Textor & Textor, 1990-2005).
3.2 Klientel im Heim
Die Kinder, die im Rahmen der Heimerziehung Hilfen erhalten, haben es oft nicht einfach. Es sind Kinder, denen die elterliche Erziehung fehlte, die ihnen Geborgenheit, Anerkennung und Orientierung für ihr Verhalten hätte geben können. Die Klientel stammt oft aus überwiegend „unvollständigen“ und aus sozial benachteiligten Schichten. Als Auslöser für die Heimunterbringung spielen vor allem Erkrankungen der Eltern, Vernachlässigungen/ Misshandlungen, Alkohol/ Drogenkonsum und Inhaftierung der Erziehenden, eine Rolle.
(vgl. Hofer, Wild, & Noack, 2002, S.66) Gerade die Klienten im Heim haben durch fehlende Liebe, Akzeptanz und Zuwendung durch die Eltern keine stabilen und sicheren Bindungen aufbauen können. Während des Aufenthalts sind diese kaum fähig Beziehungen einzugehen und selektive Bindungen zu entwickeln. Die Klientel kann sich erst nach einer längeren Unterbringungszeit auf die Erzieher und Sozialpädagogen einlassen, um intensivere, vertrauensvollere und dauerhafte Beziehungen einzugehen. (vgl. Ebeling, 2004, S. 67)
Früher waren es vorwiegend elternlose oder ausgesetzte Kinder, die im Heim aufgenommen wurden. Heute sind es unter anderem Kinder, die aus sehr unterschiedlichen Gründen in ihrer Herkunftsfamilie nicht mehr leben können, wollen oder dürfen. In der Regel sind es junge Menschen, die aus schwierigen Verhältnissen stammen. Die Betroffenen bringen bei ihrer Heimaufnahme auch ihre dementsprechend individuelle Lebensgeschichte mit.
Die heute aufgenommenen Kinder und Jugendlichen haben mit zunehmendem Alter schon mehrfache Wechsel ambulanter Hilfen, Pflegeverhältnisse und Heimunterbringungen erleben müssen. Diese Wechsel haben meist negative Folgen und erschweren eine erfolgreiche und gelingende Heimerziehung. Dies äußert sich unter anderem in persönlichen Problemen und Schwierigkeiten und der daraus entstehenden Isolation gegenüber den Fachkräften und der Heimbewohner. Zuweilen werden die traumatischen Lebenserfahrungen, andauernde Frustrationen und Erziehungs- sowie Erfahrungsdefizite erst im Laufe des Heimlebens erkennbar. (vgl. Günder, 2000, S.28f.)
Aus diesem Grund ist zu sagen: „Kinder und Jugendliche, für deren Erziehung Interventionen im Rahmen der stationären Erziehungshilfe als notwendig erachtet werden, sind solche mit besonderen Problemlagen, die gesellschaftlich, individuell und/oder familiär begründet sein können“ (Günder, 2000, S.31).
Diese Problemlagen können sich in Lern- und Leistungsrückständen, Konzentrations- und Motivationsproblemen, Desorientierung in Alltagssituationen, aggressivem und autoaggressivem Verhalten sowie psychischen und sozialen Auffälligkeiten äußern. Ein komplexeres Problem stellt der häufig auftretende Entwicklungsrückstand dar. Die Sichtbarkeit der Problemlagen spiegelt sich in Erziehungsschwierigkeiten, Schulproblemen, Rumtreiben, Delinquenz, Sucht und psychischen Störungen oder Auffälligkeiten im Sexualverhalten wieder. (vgl. Ebeling, 2004, S.14)
Die Klientel im Heim wird aus diesen Gründen des Öfteren als „verhaltensauffällig“ oder „verhaltensgestört“ bezeichnet. Im Heim sollen die emotionalen, sozialen und kognitiven Defizite bearbeitet und möglichst aufgeholt werden. Dies setzt nicht nur gute Erzieher/innen bzw. Sozialpädagoge/innen voraus, sondern auch Menschen, die den Situationen psychisch gewachsen sind.
3.3 Die Aufgaben der Sozialpädagogen im Heim
Das Berufsfeld früherer Heimerziehung war geprägt durch die Pflege, Beaufsichtigung und Versorgung elternloser Kinder. Im Laufe der letzten Jahre veränderten sich die Inhalte und Anforderungen an die Heimerziehung radikal. Anstelle des autoritären Erziehungsmusters traten Gedanken des Helfens und Förderns. Hierdurch änderte sich auch das Berufsbild. Die Rolle der „Heimerzieher“ sieht heute eine offene und globale Erwartungshaltung vor, nach der die Kinder und Jugendlichen durch pädagogische Maßnahmen gefördert werden. Diese Modifikation verlangt demnach eine bessere und höhere Qualifikation der „Heimerzieher“. (vgl. Günder, 2007, S. 114f.) Der Terminus „Heimerzieher“ umfasst hierbei sowohl Männer als auch Frauen, welche für den Beruf des Erziehers in einer stationären Einrichtung ausgebildet wurden. Sie haben ihre Ausbildung mit einem Diplom abgeschlossen und nennen sich entweder Heimerzieher oder Sozialpädagogen.[1] (vgl. Schoch, 1989, S.21) Diese übernehmen die verantwortungsvolle Aufgabe den Klienten so zu helfen, dass am Ende der Maßnahme eine Besserung zu verzeichnen ist und wenn möglich die Aufgabe der Heimerziehung erfüllt ist.
Dabei ist gemeint, dass der Klient wieder in die Familie eingliedert werden kann oder soweit auf die Gesellschaft vorbereitet wird, um in ihr ein selbstständiges Leben führen zu können. Der Sozialpädagoge/Heimerzieher versucht also das Kind oder den Jugendlichen dementsprechend zu erziehen.
In diesem Prozess der Erziehung sollen die Klienten so von Seiten der Sozialpädagogen unterstützt werden, dass sie einen Weg finden sich selbst zu ändern. (vgl. Durrant, 1996, S.32)
Ein Sozialpädagoge soll den Kindern und Jugendlichen keine heile Welt vorspielen, sondern eine „heilende“ Welt ermöglichen. Das Heim ist durch die Begegnung mit dem Sozialpädagogen ein Ort, wo Kinder und Jugendliche für ihre Entwicklung hilfreiche unkonditionale Zuwendung, Treue, Achtung und Verständnis erfahren. Es soll ein Ort sein, wo sich für Kinder und Jugendliche das Leben in der Beziehung öffnet. (vgl. Junge, 1989, S.59) Hierzu benötigt jedoch ein Sozialpädagoge die Fähigkeit, Erfahrungen zu sammeln und mit Hilfe bestimmter Ereignisse und menschlicher Beziehungen auf die unterschiedlichsten Situationen spontan reagieren zu können. (vgl. Bowlby, 2001, S. 141)
Dadurch, dass der Sozialpädagoge als direkte Bezugsperson, die meiste Zeit in unmittelbarer Beziehung zum Kind/Jugendlichen steht, hat er in der Regel die größte Informationsdichte. Diese hilft ihm, die Verhaltensweisen des Kindes/Jugendlichen und die Ursachen dafür besser einschätzen zu können. Als Bezugsperson hat er die emotionalen Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen und als Vorbild zu agieren. Diese Vorbildfunktion soll ein individuelles Wertesystem beim Klienten initiieren. (vgl. Hofmann, 1991, S. 33)
Der Sozialpädagoge muss sich dabei stark am Klienten orientieren, um genau feststellen zu können, auf welchen Entwicklungsstand sich der Klient befindet und inwieweit er mit ihm zusammenarbeiten kann. (vgl. Grzesik, 1998, S. 179)
Um mit dem Klienten so zusammenarbeiten zu können, dass Fortschritte zu verzeichnen sind, bedarf es einer gewissen Grundeinstellung. Nicht nur die Kinder und Jugendlichen müssen sich auf ein Arbeitsverhältnis einlassen können, sondern auch die sozialpädagogischen Fachkräfte. Sie benötigen in dem Fall eine positive Grundeinstellung gegenüber den Kindern und Jugendlichen. Gefühle von Wertschätzung, Akzeptanz und Anerkennung können nur vermittelt werden, wenn die Fachkräfte ohne Vorurteile an den Hilfeprozess herantreten. Auch ein aufgeschlossenes Verhalten und die verständnisvolle Anteilnahme ist Grundlage eines respektvollen Umgangs miteinander. So kann man ein angstfreies Klima schaffen und die Grundqualifikation der Beziehungskompetenz auf der Ebene des Kontaktes mit dem Klienten wird gewährleistet.
Des Weiteren ist die soziale Kompetenz sehr wichtig für die Arbeit mit dem Klienten. Mit der sozialen Kompetenz ist hier die Fähigkeit gemeint, sich auf die Klienten mit ihren Bedürfnissen und Anforderungen einzulassen. Dabei ist das Nachdenken über die Situation und deren Bedingungen selbst von Vorteil. Gerade die Fähigkeit berufliche Beziehungen aufbauen bzw. aktiv herstellen zu können, zeugt von großer Begabung im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen. (vgl. Herriger, & Kähler, 2003, S. 146) Über dies hinaus umfasst die soziale Kompetenz […] „die Fähigkeit des beruflichen Helfers, balancierte und konstruktive Arbeitsbeziehungen zu Kooperationspartnern innerhalb und außerhalb der eigenen Institution herstellen und pflegen zu können“ (Herriger & Kähler, 2003, S. 146).
Wie schon erwähnt hat der Sozialpädagoge die Aufgabe, die Heimkinder zu erziehen. Das geht meist nach Plan (Erziehungsplan) von statten. Dabei sollte er die Genese der Verhaltensstörungen kennen und Zusammenhänge zu ihrer Entstehung und Festigung herstellen können. Durch die enge Beziehung zum Sozialpädagogen ist dies wie schon oben angeführt realisierbar. Hierzu sind Kenntnisse der Entwicklungspsychologie von Nöten.
Des Weiteren sollte der Sozialpädagoge ein Verständnis für die familiäre Situation der Heimkinder haben. Dabei spielen die vorhandenen Eltern - Kind - Beziehungen eine Rolle, denn wie schon benannt, können sie großen Einfluss auf das Verhalten der Kinder haben. Diese angeeigneten Beziehungsmuster sollten erkannt und für die Entwicklung neuer Verhaltensweisen sowie für korrigierende Erfahrungen nutzbar gemacht werden. Hieraus kann ein Sozialpädagoge konkrete Ziele formulieren, in Teilschritte zerlegen und einer gewissen Rangordnung zuordnen. Das Fachwissen verbunden mit dem Wissen um den Klienten muss nun in die Erziehungsplanung integriert werden, indem Theorie und Praxis verbunden werden. Dabei wird das Gesamtkonzept der Einrichtung mit einbezogen. (vgl. Junge, 1989, S.59) In der beabsichtigten Hilfeleistung sollte man immer bedenken, dass den Kindern innerhalb der Heimerziehung das so wichtige Moment der Eltern – Kind – Bindung fehlt. Es ist jedoch nicht nur zum Nachteil der Heimbewohner ausgelegt. Die Kinder/Jugendlichen erfahren durch den Sozialpädagogen eine andere Art der Emotionalität und diese lässt in vielen Fällen eine Entwicklungsförderung zu. (vgl. Günder, 2000, S. 154)
„ In besonderer Weise hat der Erzieher denjenigen, die aus gestörten Sozialbeziehungen stammen,
zu helfen, ihre psychischen und sozialen Probleme zu bewältigen, ein positives Selbst- und Weltbild
zu gewinnen und sie damit zu befähigen, nach Ende des Heimaufenthalts stabile soziale
Beziehungen herstellen und erhalten zu können“ (Hofmann, 1991, S. 33).
Während dieses Hilfeprozesses sollten jedoch die Beziehungen zum Kind/Jugendlichen nie zu eng werden. Eine gewisse Distanz sollte immer gewahrt bleiben, da der Kontakt zu den Eltern immer im Vordergrund steht. Das Ziel ist die Rückführung in die Familie. Demzufolge hat der Sozialpädagoge die Aufgabe, den Kontakt zwischen Eltern und Kind zu ermöglichen. Dabei nimmt er auch ab und an die Rolle des Vermittelnden ein. Diese Kontaktaufnahme zu den Eltern kann sich erschweren, wenn das Kind/der Jugendliche eine zu enge Beziehung zum Sozialpädagogen hat und ihn als Vater oder Mutter ansieht.
Aus diesem Grund ist es wichtig, […] „ein Fundament von wechselseitigem Vertrauen und Reziprozität herzustellen und gleichsam eine kritisch- reflektierende Distanz zu den Lebensentwürfen und Alltagsinterpretationen der Klientel zu wahren“ (vgl. Herriger & Kähler, 2003, S. 146).
3.4 Nähe – Distanz- Verhältnis
Die notwendige Nähe des Sozialpädagogen zu den Kindern/Jugendlichen im Heim kann zu einer starken persönlichen Betroffenheit führen. Sie birgt die Gefahr in sich, die unerlässliche berufliche Distanz zu verringern. Der Sozialpädagoge sollte daher seine eigenen Gefühle, Haltungen, Einstellungen, Werte, Normen kennen und deren Abhängigkeit von der Gesellschaft berücksichtigen. In einer guten Arbeitsatmosphäre sollte der Sozialpädagoge die Gelegenheit erhalten, über seine Gefühle und Ängste sowie seine Betroffenheit zu reden.(vgl. Junge, 1989, S.63)
Bisher und im Weiteren wird davon gesprochen, dass Beziehungen einerseits in der Heimerziehung bedeutsam sind und andererseits Voraussetzung für eine dauerhafte Erziehung im Heim und demnach auch der Hilfe ist. Diese tragfähige auch heilende Beziehung zu den Heimbewohnern wird immer wieder angestrebt und als Mittel für weitere Maßnahmen verwendet. Die Beziehung ist der eigentliche Zuständigkeits- und Kompetenzbereich der Sozialpädagogen. „Die Beziehung bildet den Boden, den Ausgangspunkt für alle erzieherischen Bemühungen – ohne Beziehung keine Erziehung“ (Simmen, 1998, S.24).
Das Problem bei dieser Sichtweise ist, dass der Sozialpädagoge seine Handlungskompetenz nur darin sieht, eine Beziehung aufzubauen. Er berücksichtigt dabei oft nicht, dass es Grenzen geben muss. Die Grenzen einer Überbehütung und Überversorgung sind aus dem Grund oft schnell erreicht. (vgl. Simmen, 1998, S.25)
Durch den täglichen engen Kontakt mit den Heimbewohnern ist es schwer, eine Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden. Aus diesem Grund ist es förderlich, sein pädagogisches Verhalten regelmäßig zu reflektieren und auszuwerten. In dem Fall hat der Sozialpädagoge einen Überblick über sein eigenes Handeln und kann rechtzeitig reagieren. Von Vorteil ist daher auch das regelmäßige Gespräch mit Teamkollegen, die dieses Verhalten fast täglich sehen und somit bewerten und einschätzen können. Einem Sozialpädagogen im Heim kann es schwer fallen, entsprechend des Nähe – Distanz – Problems richtig zu agieren. Zudem haben die Eltern der Kinder und Jugendlichen auch gewisse Erwartungen an den Sozialpädagogen. Diese Erwartungen erschweren es wiederum, die Distanz zum Heimbewohner zu wahren.
3.4.1 Erwartungen an den Sozialpädagogen von Seiten der Eltern
„Die Eltern weisen oder lassen ihr Kind oft in eine Institution mit der Hoffnung einweisen, dass sie von Problemen entlastet werden. Sie wollen ein fachmännisch behandeltes Kind zurückerhalten, ohne sich dabei in der Regel selbst mit einzubeziehen oder mitzuhelfen“ (Kindschuh van Roje, 1989, S.30). Die Eltern möchten, dass der Sozialpädagoge die kaputten Familienkonstellationen wieder „repariert“. ( vgl. Durrant, 1996, S.33)
Der Heimerzieher ist hier für eine befristete Zeit das so genannte „Ersatzelternteil“. So werden eine berufliche oder professionelle Haltung als auch ein Gefühl von Elternersatz erwartet. (vgl. Kindschuh van Roje, 1989, S.30)
3.4.2 Erwartungen an den Sozialpädagogen von Seiten der Klientel
Kinder, die in ein Heim aufgenommen werden, fühlen sich dadurch oft von ihren Eltern bestraft und lassen ihre Wut über diese Entscheidung meist am Sozialpädagogen aus. Dieser hat aber überhaupt keinen Einfluss darauf, ob die Hilfe notwendig für das Kind ist, denn die wichtigsten Entscheidungsschritte sind bereits mit der Aufnahme des Kindes abgeschlossen. Der Sozialpädagoge hat lediglich Einfluss darauf, die Maßnahme zu verkürzen oder zu verlängern. Er ist mit der Aufnahme des Kindes vor die Aufgabe gestellt zu helfen, das heißt, das Kind in die Gruppe zu integrieren. Er muss sich nun im Rahmen seines pädagogischen Fachwissens ein Konzept erarbeiten, um dem Kind überhaupt erst einmal die Möglichkeit eines Einlassens auf die neuen Bedingungen zu geben. Das Kind erwartet in dem Fall vom Erzieher Trost, Beschäftigung und eine Möglichkeit seine Aggressionen abzureagieren. Der Sozialpädagoge steht hierbei unter großem psychischen Druck, da die Kinder ihre schweren Beziehungsstörungen auszuleben versuchen. Gerade die bisher erlernten Beziehungsmuster in der Familie kommen dabei stark zur Geltung. (vgl. Kindschuh van Roje, 1989, S.30)
Hier ist mit der Beziehungsarbeit zum Kind anzusetzen, denn sie bildet das Fundament für eine gemeinsame Arbeitsgrundlage und öffnet die Tür einer gelingenden Hilfe zur Erziehung.
4. Ziele und Aufgaben der Heimerziehung im Kontext des KJHG
In den meisten Einrichtungen ist ein schrittweises Vorankommen üblich, indem die Familie des Betroffenen entlastet werden soll. Durch ein gemeinsames Erarbeiten von Lösungswegen soll der Zusammenhalt in der Familie gestärkt werden, um eine Rückführung in diese zu ermöglichen. Dabei wird eine gemeinsame Arbeitsgrundlage geschaffen, die sich mit Hilfe der Erfahrungen des Klienten und den qualifizierten Wissen der Fachkräfte aufbaut. In regelmäßigen Abständen wird hier über die individuelle und kontinuierliche Entwicklung jedes einzelnen Kindes gesprochen. Deshalb werden die so genannten Hilfeplangespräche auf Seiten des Jugendamtes halbjährlich vereinbart.
Hierbei werden das jeweilige Jugendamt als Kostenträger (§ 85 KJHG), der Kontakterzieher[2] des Kindes und die Sorgeberechtigten zusammengeführt. Wichtig dabei ist die Kooperation aller Parteien. Die Ergebnisse diagnostischer und planender Arbeit werden schriftlich im Hilfeplan dokumentiert. Dabei soll konkretisiert werden, worin der erzieherische Bedarf besteht, welche Hilfeart angemessen ist und welche Leistungen als notwendig angedacht sind. Der so genannte Hilfeplan ist im Paragraphen 36 des KJHG festgelegt. Mittels des Hilfeplangesprächs wird dann die Hilfemaßnahme betrachtet und auf ihre Wirksamkeit überprüft. Inhalte dieser Hilfeplangespräche sind beispielsweise der derzeitige Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen. Wichtig für alle Beteiligten sind die bisherigen Entwicklungsfortschritte, besondere Ereignisse und Vorkommnisse sowie die Situation in der Schule und die Integration des Kindes oder Jugendlichen in der Heimgruppe. Die bisherigen beobachtbaren Veränderungen des Kindes oder Jugendlichen bieten unter anderem die Grundlage für die Abklärung, ob die Hilfe weiterhin für geeignet und notwendig gehalten wird. Hieraus erfolgt somit eine Perspektivenabklärung für das Kind oder den Jugendlichen. (vgl. Günder, 2000, S.48f)
Der Hilfeplan beinhaltet zudem wichtige Aussagen hinsichtlich des Gesamtziels nach Paragraphen 34 KJHG, der Grund- und Zusatzleistungen, der Dauer sowie Perspektiven und Ziele bezüglich des Jugendlichen und seiner Eltern. Daneben sind Aspekte der Kooperation mit dem Jugendamt festgelegt. Diese erfolgen in Form von Informations- und Berichtspflichten. Damit verbunden ist ein Vertrag zwischen Jugendamt und der Einrichtung über die zu erbringenden Leistungen. (vgl. Ebeling, 2004, S. 58)
Bereits eine Einbeziehung der Betroffenen im Hilfeplanungsprozess lässt ein gewisses Maß an Vertrauen in die Beteiligungsbereitschaft und -fähigkeit der Klientel und ihr Interesse an einer guten Lösung entstehen. (vgl. Blandow, 1999, S.137)
Wie schon erwähnt ist die Heimerziehung im KJHG eine der „Hilfen zur Erziehung“, auf die ein Rechtsanspruch besteht, „… wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und eine Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist“ (Stascheit, 2005, S.1039).
Im KJHG werden die Aufgaben und Zielsetzungen der Heimerziehung beschrieben. In diesem Gesetz ist nach Paragraphen 34 festgelegt, welche Aufgaben die Heimerziehung hat. Vorrangig soll das Kind oder der Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in seiner Entwicklung gefördert werden. Weiterhin soll dem Kind/Jugendlichen ermöglicht werden, in die Herkunftsfamilie zurückzukehren. Dies geht allerdings nur bei einer erzielten Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Familie. Sollte diese Rückführung in die Herkunftsfamilie scheitern, da eine Besserung des Ist – Zustandes nicht abzusehen ist, besteht im Rahmen der Heimerziehung die Chance, das Kind auf eine Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten. Eine weitere Aufgabe der Heimerziehung besteht darin, die Betroffenen auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Dazu gehört die Beratung und Unterstützung von Seiten der Fachkräfte. (vgl. Stascheit, 2005,S. 1040)
Der Paragraph 35 a des KJHG spielt hierbei auch eine Rolle. In diesem Paragraphen wird der Anspruch auf die Eingliederung der Klienten sichergestellt. Des Weiteren wird die Hilfe nach dem Bedarf ermittelt, wobei das Maß der Einzelfall ist. Bei der zu leistenden Hilfe werden hierfür geeignete Einrichtungen vorgesehen, die die aufgeführten Ziele erreichen können und den Hilfebedarf decken. Da im KJHG der Familienbezug sehr wichtig ist, sind ambulante Erziehungshilfen den (voll)stationären dann vorzuziehen, wenn die familiären Beziehungsstrukturen und Bindungen noch einigermaßen vorhanden und zu erwarten sind.
Ist dies nicht oder nur in einem geringen Maße erreichbar, wird die Möglichkeit einer Erziehung im Heim in Betracht gezogen.
4.1 Ergänzende Ziele und Aufgaben der Heimerziehung
Da sich alle Menschen in einem ständigen Veränderungsprozess befinden, in dem sie versuchen, sich selbst, ihren Beziehungen und ihrem Schicksal, „einen Sinn zu geben“, muss der Fokus der Heimerziehung unter anderem auf die Gesamtheit der Geschehnisse im Leben der Klienten gelegt werden. Wenn Menschen Familienprobleme haben, die sie nicht selbst lösen können, ist das eine Reflexion des „Feststeckens“. Dieses Stagnieren kann die Betroffenen deprimieren, da es für jeden ein Zeichen von Schwäche ist und bedeutet, dass man Fehler gemacht hat. Die Stärken und Ressourcen, die ein jeder hat, werden dabei außer Acht gelassen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Sozialpädagogen der (voll)stationären Erziehungshilfe gerade dafür einen Blick haben. Das heißt, sie sollen ressourcenorientiert arbeiten. (vgl. Durrant, 1996, S.51) Die (voll)stationäre Erziehungshilfe wird hierbei auch gern als „Übergang“ gedeutet. Das heißt, sie soll bestimmte Verhaltensänderungen bewirken und gegebenenfalls eine Brücke in einen neuen Lebensabschnitt darstellen. Diese Zeit des Übergangs ist eine Zeit des Übens und Experimentierens, mit einem unvermeidlichen Auf und Ab. Zusammenfassend ist also zu sagen, dass das Ziel der (voll)stationären Erziehungshilfe unter anderem darin liegt, dass junge Menschen und ihre Familien imstande sind, sich selbst als kompetent und erfolgreich zu erleben. Durch diesen Prozess soll es ihnen ermöglicht werden, eine neue Sichtweise von sich selbst zu entwickeln, die ihnen erlaubt, fortlaufend hilfreiches, akzeptableres und erfolgreicheres Verhalten zu entdecken. (vgl. Durrant, 1996, S.52)
Neben dem Wohnen im Heim, der Unterstützung in der Schule und Ausbildung sowie Freizeitgestaltung bemüht sich die Erziehung in den Heimen also auch um die Förderung der allgemeinen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Hierdurch sollen die bestehenden Schwierigkeiten und Auffälligkeiten verringert werden. Im Vordergrund steht immer das Ziel, die Kinder so zu fördern, dass sie in Zukunft ihre Probleme besser bewältigen können. Unter anderem gehören die Förderung des Selbstbewusstseins, der adäquate Umgang mit Konflikten sowie die zunehmende Verselbstständigung zum Ziel der Heimerziehung. (vgl. Günder, 2000, S.48f.)
4.2 Zielformulierung
Innerhalb der Heimerziehung nehmen viele Faktoren auf die Erziehung Einfluss. Ein besonders wichtiger Aspekt liegt hierbei in der gemeinsamen Zielsetzung. Meist sind sie vom Helfer (Sozialpädagogen) aufgestellt worden und nicht im gemeinsamen einvernehmen mit dem Klienten, der das Ziel erreichen muss. Von einem Wollen der Zielerreichung kann nur die Rede sein, wenn die Klientel mitreden kann und sich nicht gezwungen fühlt für andere etwas zu tun. So ist zu sagen, dass die Partizipation an der Formulierung der Ziele mit ausschlaggebend ist für einen Erfolg. Die Partizipation der Kinder und Jugendlichen im Heim soll im späteren Verlauf noch eine Rolle spielen.
„Die Art, wie Ziele formuliert werden, kann einen grundlegenden Einfluss darauf haben, welche Fortschritte die Fremdunterbringung macht“ (Durrant, 1996, S.387).
Im Allgemeinen drücken die Ziele eine Orientierung auf Probleme aus. Das heißt, es wird formuliert, an welchen Problemen die betreffende Person arbeiten möchte oder sollte und wie eine Lösung erarbeitet werden kann. Ziele sind also mit dem Überwinden von Problemen oder dem Verändern problematischer Situationen eng verbunden. (vgl. Durrant, 1996, S.87) Hieraus ergibt sich, dass Ziele so formuliert sein müssen, dass sie für jeden erreichbar sind und dementsprechend auf die jeweilige Lebenssituation zugeschnitten sind. Ziele sollten stets „smart“ sein, d.h. „spezifisch“ , „messbar“ , „aktionsorientiert“, „realistisch“ und „terminiert“, sowie herausfordernd, positiv und eindeutig formuliert.(vgl. Ebeling, 2004, S.33)
[...]
[1] Im weiteren Verlauf kommen hier noch die Bezeichnungen sozialpädagogische Fachkräfte, berufliche Helfer, Mitarbeiter der sozialen Arbeit sowie Personal hinzu. Alle sind mit den pädagogischen Fachkräften im Heim gleichzusetzen. Erzieher sind hierbei nicht ausreichend qualifiziert, leisten jedoch meist die gleiche Arbeit wie ein Sozialpädagoge.
[2] Ein Kontakterzieher steht dem Kind kontinuierlich zur Seite und ist zuständig für alles, was das Kind betrifft. Er fertigt in regelmäßigen Abständen Entwicklungsberichte über das Kind an, welche Grundlage für das Hilfeplangespräch ist. Hierdurch wird gewährleistet, dass jedes Kind in jeder Situation seinen speziellen Ansprechpartner hat und eine kontinuierliche und individuelle Betreuung erfährt.