Das Hauptgespräch in Platons Dialog „Phaidon“ ist neben der Beweisführung des Sokrates über die Unsterblichkeit der Seele zudem durch die Einwände von Kebes und Simmias charakterisiert. Sokrates, welcher schon während seiner Ausführungen bemerkte, dass Simmias mit diesen nicht komplett einverstanden war, forderte ihn auf seine Bedenken offen zu äußern. Zudem schätzte Sokrates das Vorbringen des Einwandes, da das ihm zeigte, dass Simmias seinen Reden genau zugehört und darüber nachgedacht hat und er nicht bloß seine Reden rezipiert.
Simmias Einwand beruht darauf, dass für ihn die Seele, welche er als Harmonie des Körpers setzt, diesen Körper nicht überdauern kann. Die Widerlegung dieses Zweifels durch den unerschütterten Sokrates bezieht sich vor allem darauf zu zeigen, dass die Seele nicht als eine Harmonie verstanden werden kann. Sokrates führt die Widerlegung sehr raffiniert durch. Er greift immer wieder den Einwand von Simmias auf und zeigt ihm, wie die Argumentationskette lauten müsste, wenn er die Seele als Harmonie beweisen würde.
Platon "Phaidon" - ein Essay über die Widerlegung des Einwandes von Simmias
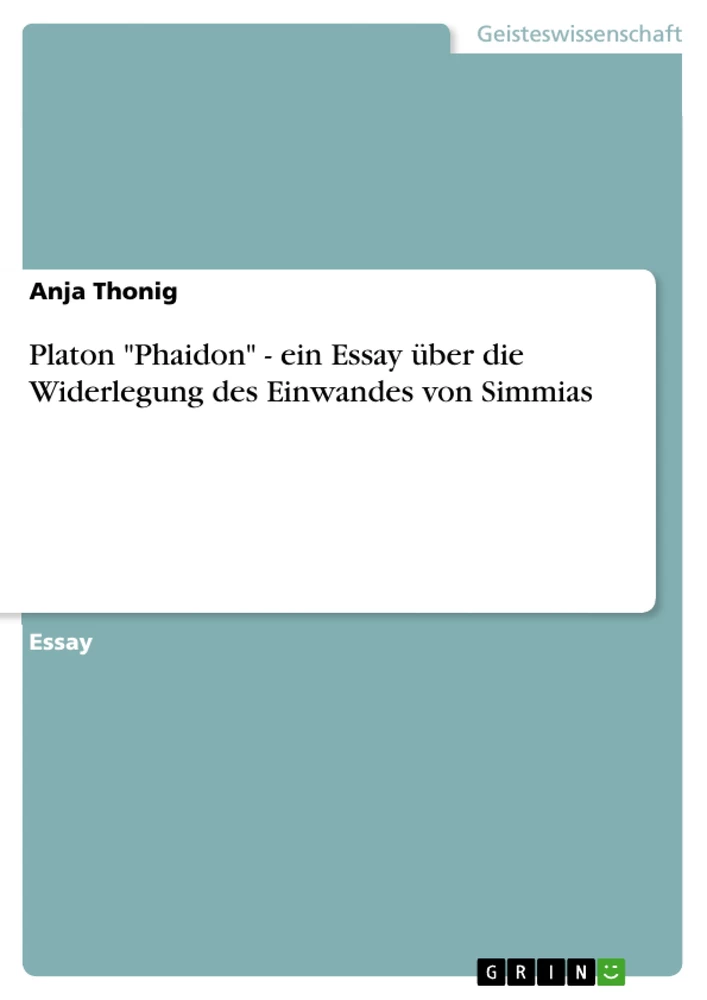
Essay , 2007 , 4 Seiten
Autor:in: Anja Thonig (Autor:in)
Philosophie - Philosophie der Antike
Leseprobe & Details Blick ins Buch
