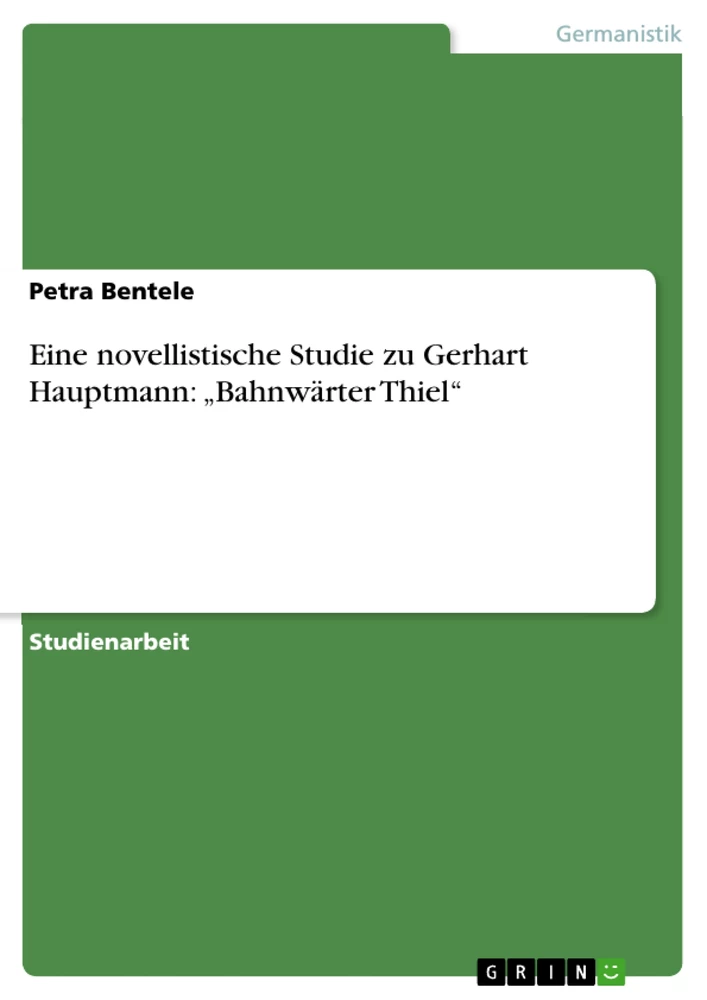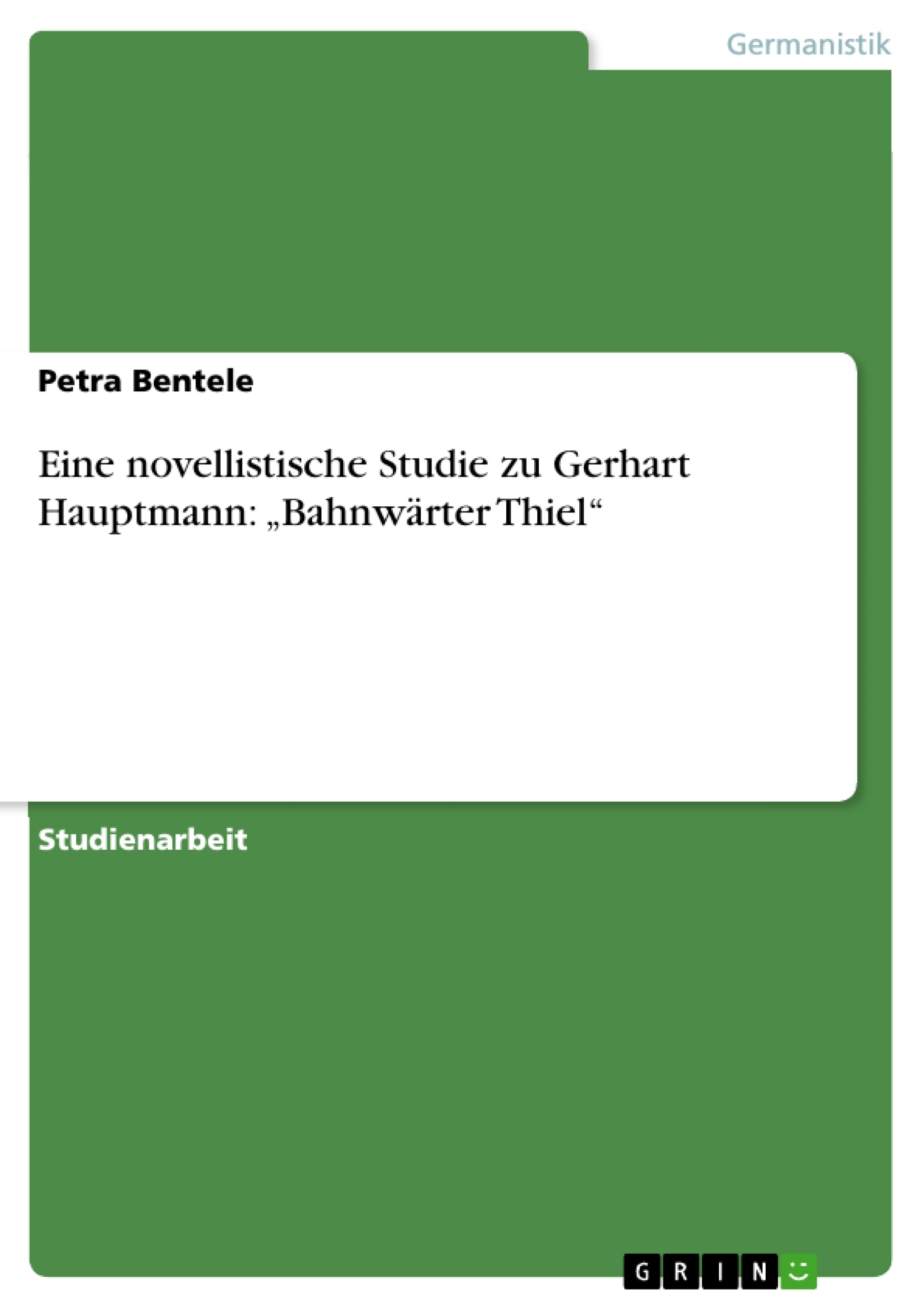Die sogenannte „Gründerzeit“, in die Gerhart Hauptmann (1862-1946) hineingeboren wurde, war bestimmt gewesen durch einen tiefgreifenden Prozess geistiger und zugleich politischer Umwälzungen. Die moderne Wissenschaft, die Entwicklungen der modernen Technik und die durch die Industrialisierung sich ergebenden gesellschaftlichen Veränderungen prägten das Bewusstsein dieser Zeit.
Vor diesem Hintergrund wuchs die Generation der Realisten und nachfolgenden Naturalisten heran. Was ihre Erfahrungen betraf, waren sie von den Vorstellungen des Idealismus grundsätzlich verschieden. Man erkannte, dass man in einer neuen Zeit lebte und dass diese neue Zeit ihren eigenen Gesetzen zu folgen hatte. Die Naturwissenschaften lieferten ihnen ein Modell für die Erkenntnis der Wirklichkeit und die Metaphysik als Grundlage geistiger Auseinandersetzung war nicht mehr relevant. Darwin, Haeckel, Marx, Feuerbach und die Psychoanalyse Sigmund Freuds wurden zu den geistigen Vorbildern dieser Künstlergeneration.
Auch Gerhart Hauptmann war ein Kind dieser Zeit. Das belegt bereits sein Frühwerk, die novellistische Studie „Bahnwärter Thiel“, die in der Zerstörung des idealistischen Bildes vom freien harmonischen Menschen eine andere, realistische Anschauung freilegt, die die Gefährdungen und Abgründe, das Triebhafte im Menschen begreift. Hauptmann war bis dahin noch kaum bekannt gewesen; erst die Uraufführung seines ersten Dramas „Vor Sonnenaufgang“ machte ihn 1889 zum Repräsentanten der jungen „naturalistischen“ Literaturbewegung. „Bahnwärter Thiel“ hingegen bezeichnet eine Schwellensituation in der neueren Geschichte des deutschen Erzählens, bei der die Frage in den Vordergrund rücken soll, inwieweit Hauptmann in seiner „novellistische(n) Studie“ den „poetischen Realismus des 19. Jahrhunderts“ fortsetzt? Die Novelle entstand im Jahre 1887. Hauptmann hatte sich mit seiner Frau aus Berlin-Moabit zurückgezogen und in einer Villa am Stadtrand eingemietet. Er wollte sich mit schriftstellerischen Versuchen und privaten Studien beschäftigen. Das Vermögen seiner Frau ermöglichte ihm ein unabhängiges Leben. Die Welt seiner Erzählung bezog Hauptmann aus seiner unmittelbaren Umgebung in Erkner. Es ist die Welt „der kleinen Leute“, die er bei seinen Spaziergängen kennen gelernt hatte und die Natur des märkischen Kiefernwaldes, die den atmosphärischen Rahmen abgaben. Hauptmann berichtet selbst in der Autobiographie seiner Anfänge:
Inhaltsverzeichnis
I Einleitung
II Die „Welt der kleinen Leute“
III Der „poetische Realismus“ und die „Symbolsprache der Novelle“
IV Die „gespaltene Existenz“ des Bahnwärter Thiels und die Natur, die Eisenbahn, die Geleise als dessen „Versinnbildlichung“
V Die „Macht des Unbewussten“ und Sigmund Freud
VI Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
I Einleitung
Die sogenannte „Gründerzeit“, in die Gerhart Hauptmann (1862-1946) hineingeboren wurde, war bestimmt gewesen durch einen tiefgreifenden Prozess geistiger und zugleich politischer Umwälzungen. Die moderne Wissenschaft, die Entwicklungen der modernen Technik und die durch die Industrialisierung sich ergebenden gesellschaftlichen Veränderungen prägten das Bewusstsein dieser Zeit.
Vor diesem Hintergrund wuchs die Generation der Realisten und nachfolgenden Naturalisten heran. Was ihre Erfahrungen betraf, waren sie von den Vorstellungen des Idealismus grundsätzlich verschieden. Man erkannte, dass man in einer neuen Zeit lebte und dass diese neue Zeit ihren eigenen Gesetzen zu folgen hatte. Die Naturwissenschaften lieferten ihnen ein Modell für die Erkenntnis der Wirklichkeit und die Metaphysik als Grundlage geistiger Auseinandersetzung war nicht mehr relevant. Darwin, Haeckel, Marx, Feuerbach und die Psychoanalyse Sigmund Freuds wurden zu den geistigen Vorbildern dieser Künstlergeneration.
Auch Gerhart Hauptmann war ein Kind dieser Zeit. Das belegt bereits sein Frühwerk, die novellistische Studie „Bahnwärter Thiel“, die in der Zerstörung des idealistischen Bildes vom freien harmonischen Menschen eine andere, realistische Anschauung freilegt, die die Gefährdungen und Abgründe, das Triebhafte im Menschen begreift. Hauptmann war bis dahin noch kaum bekannt gewesen; erst die Uraufführung seines ersten Dramas „Vor Sonnenaufgang“ machte ihn 1889 zum Repräsentanten der jungen „naturalistischen“ Literaturbewegung. „Bahnwärter Thiel“ hingegen bezeichnet eine Schwellensituation in der neueren Geschichte des deutschen Erzählens, bei der die Frage in den Vordergrund rücken soll, inwieweit Hauptmann in seiner „novellistische(n) Studie“ den „poetischen Realismus des 19. Jahrhunderts“ fortsetzt?
II Die „Welt der kleinen Leute“
Die Novelle entstand im Jahre 1887. Hauptmann hatte sich mit seiner Frau aus Berlin-Moabit zurückgezogen und in einer Villa am Stadtrand eingemietet. Er wollte sich mit schriftstellerischen Versuchen und privaten Studien beschäftigen. Das Vermögen seiner Frau ermöglichte ihm ein unabhängiges Leben. Die Welt seiner Erzählung bezog Hauptmann aus seiner unmittelbaren Umgebung in Erkner. Es ist die Welt „der kleinen Leute“, die er bei seinen Spaziergängen kennen gelernt hatte und die Natur des märkischen Kiefernwaldes, die den atmosphärischen Rahmen abgaben. Hauptmann berichtet selbst in der Autobiographie seiner Anfänge:
„In Erkner nahm ich mein altes Leben mit Wanderungen und Beobachtungen aller Art wieder auf. Ich machte mich mit den kleinen Leuten bekannt, Förstern, Fischern, Kärtnerfamilien und Bahnwärtern, betrachtete eine Waschfrau, ein Spitalmütterchen eingehend und mit der gleichen Liebe, als wenn sie eine Trägerin von Szepter und Krone gewesen wäre. Ich unterhielt mich mit den Arbeitern einer nahen chemischen Fabrik über ihre Leiden, Freuden und Hoffnungen und fand hier, ... besonders auf den einsamen Dörfern, ein Menschenwesen, das sich seit einem halben Jahrtausend und länger unverändert erhalten hatte.“[1]
Nach eigenen Aussagen und Berichten von Freunden galten seine Studien zu dieser Zeit vor allem politischen und soziologischen Schriften. Das Manuskript seiner Erzählung, „Bahnwärter Thiel“, schickte Hauptmann an „Die Gesellschaft“, das Organ der Münchner Naturalisten. Es fand begeisterte Aufnahme und erschloss ihm erstmals ein größeres Lesepublikum. Mit dieser Erzählung trat er, Gerhart Hauptmann, nach eigenem Urteil, „als Dichter in die Welt“.[2]
III Der „poetische Realismus“ und die „Symbolsprache der Novelle“
Hauptmanns Erzählen geht von der empirischen Anschauung, von der Abbildung einer konkreten Wirklichkeit aus, das sich an die gegenständliche Umwelt und an psychologisch erfassbare Seelenvorgänge hält. Der Mensch wird hineingestellt in die Natur und in die Besonderheiten seiner sozialen Existenz. Sie sind die beiden Bereiche, die sein Leben ausmachen. Dieser auf dem Beobachten aufbauende Realismus ist die Basis seines Erzählens. Ebenso die Beschreibung des Menschen im Alltag, die hinsichtlich der Problemstellung seiner „Studie“, die Darstellung sexueller Triebgebundenheit und der Schilderung eines in den Irrsinn stürzenden Menschen, geradezu modern war.
Dies zielte bereits ansatzweise auf jene naturalistische Darstellung der „ursprünglichen“ Existenz des Menschen, dort wo die Tünche der Kultur und Zivilisation fehlte oder abgefallen war, die entscheidende Wahrheit über die menschliche Seele und ihre Bedürfnisse. Auch der Begriff „Studie“ bezog Distanz, hob sich von dem Verdacht des rein Erfundenen ab und deutet die Beobachtung unmittelbar am Objekt an. Dabei bedient sich Hauptmann der erzählerischen Objektivität. Er tritt hinter dem Dargestellten zurück und vermeidet alles, was als Beurteilung und Wertung zu verstehen ist.[3]
Dennoch kann die Erzählung trotz der Kunst des genauen, sinnlich anschaulichen Beobachtens, auch im beiläufigsten Detail, nicht als „naturalistisch“ bezeichnet werden, denn es fehlt sowohl die Echtheit von Dialog und Wort (Mundart und Slang) und - das ist entscheidend - nichts ist hier als Stoff nur beschreibender Selbstzweck.[4] Alle dargestellte Wirklichkeit wird noch in ein „dichterisches Symbolgefüge“ übertragen, das heißt der Dichter verwandelt sie zu Bildern, die etwas bedeuten. Es ist diese dichterische Bildwelt, die der Erzählung den „poetischen“ Zusammenhang gibt. Wirklichkeit wird hier Kunstwirklichkeit in der Naturgeschehen, technisches Geschehen und menschliches Geschehen nicht voneinander zu lösen sind.
Hauptmann schildert - und das ist die eigentliche Stärke seiner realistischen Erzählkunst - einerseits in nüchterner Distanz, in einem sachlichen Berichtstil, während andererseits die abgründigen, elementaren Kräfte stark und unmittelbar erlebt und die unheimliche Stimmung durch Bilder verdeutlicht werden, in denen sinnliche Außenwelt und seelische Innenwelt ineinander übergehen. Mit dieser Erzählweise setzt Hauptmann den „poetischen Realismus des 19. Jahrhunderts“ fort und gibt ihm dennoch eine eigene originäre Prägung.
Allen Interpreten der Erzählung ist zudem die eindringliche Geschlossenheit und Konzentration der Handlung aufgefallen. Geschlossenheit und Konzentration, ein Konflikt und seine Lösung, die Ökonomie des Erzählens, dazu die geschlossene Form, eine Handlung mit deutlichem Anfang und Ende, der überraschende Ausgang. Hauptmann begrenzt sich in seinem Frühwerk auf die novellistische Form und nimmt, auf moderne Weise verändernd, deren symbolisches Sprechen auf. Damit deutet seine Erzählung auf die „Novellentradition des 19. Jahrhunderts“ zurück.
Allerdings gibt es bis jetzt keine wirklich befriedigende Novellendefinition und hat es auch zu keiner Zeit gegeben. Alle Definitionsversuche schließen und schlossen „Dichtungen aus, die zu anderen Zeiten und von anderen zweifelsfrei der Kategorie „Novelle“ zugerechnet wurden.“[5] Für Goethe ist jede Novelle „eine sich ereignete unerhörte Begebenheit.“[6] Man denkt in diesem Fall sofort an Kafkas Verwandlung. Dagegen führt Heyse, Literaturnobelpreisträger und Verfasser von über 100 Novellen, die aus „Boccaccios Falkennovelle“ gewonnene Formel ein, dass der Erzähler einer Novelle sich immer zuerst nach „dem Falken“, einem „Dingsymbol“ zu fragen habe, das heißt einem Gegenstand von symbolhafter Bedeutung, der an bedeutenden Stellen wiederholt erscheint.[7]
[...]
[1] Volker Neuhaus, Erläuterungen und Dokumente. Gerhard Hauptmann. Bahnwärter Thiel. Stuttgart 1974. S. 24
[2] Ebd. S. 25.
[3] Herbert A. und Elisabeth Frenzel, Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriss der dt. Literaturgeschichte. Bd. 2. Vom Realismus bis zur Gegenwart. München 1998. S. 457-492.
[4] Ebd. S. 457-492.
[5] Herbert Krämer (Hrsg.), Theorie der Novelle. Arbeitstexte für den Unterricht. Stuttgart 1976. S. 5
[6] Ebd. S. 29.
[7] Paul Heyse, Einleitung zu „Deutscher Novellenschatz“, „Meine Novellistik“ (Ausschnitte).
In: H. Krämer (Hrsg.) Theorie der Novelle. S. 38-46.