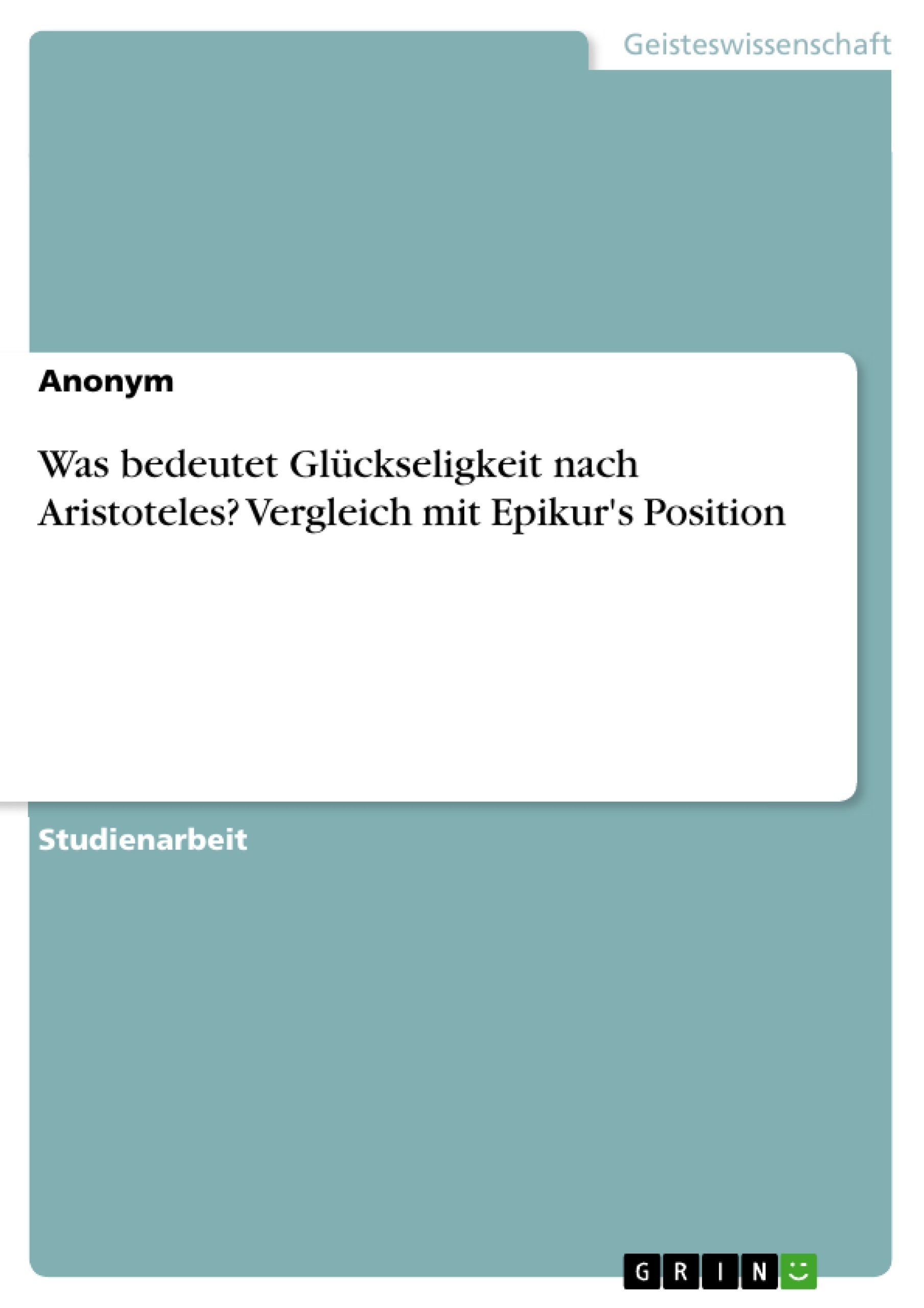Ziel dieser Hausarbeit ist es, den Begriff der Glückseligkeit nach Aristoteles und Epikur zu erarbeiten und deren Unterschiede aufzuweisen.
Was bedeutet Glückseligkeit nach Aristoteles? Welche Bedeutung hat die Glückseligkeit für Epikur? Die Frage nach der Glückseligkeit ist eine zentrale Themenstellung in der Philosophie, mit welcher sich viele Philosophen auseinandergesetzt haben. Die vorliegende Hausarbeit soll den Begriff der Glückseligkeit betrachten. Dabei steht besonders die Definition nach Aristoteles im Fokus. Allgemein ist bekannt, dass Aristoteles die Glückseligkeit als höchstes Gut bewertet. Durch das Vergleichen einer weiteren Position sollen Unterschiede und Übereinstimmungen erarbeitet werden. Hierbei soll die Position des Philosophen Epikur untersucht werden. Bewusst wird ein Philosoph, der kurz nach Aristoteles lebte, aus der antiken Philosophie zum Vergleich herangezogen.
Zunächst soll die Position Aristoteles‘ untersucht werden. Es soll ein grundlegendes Verständnis für seine Interpretation der Glückseligkeit geschaffen werden. Für einen zentralen Teil der Recherche soll unter anderem das Buch der Nikomachischen Ethik verwendet werden. Anschließend wird die Position von Epikur untersucht, nachfolgend werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten erarbeitet.
Was bedeutet Glückseligkeit nach Aristoteles? Vergleich mit Epikur's Position
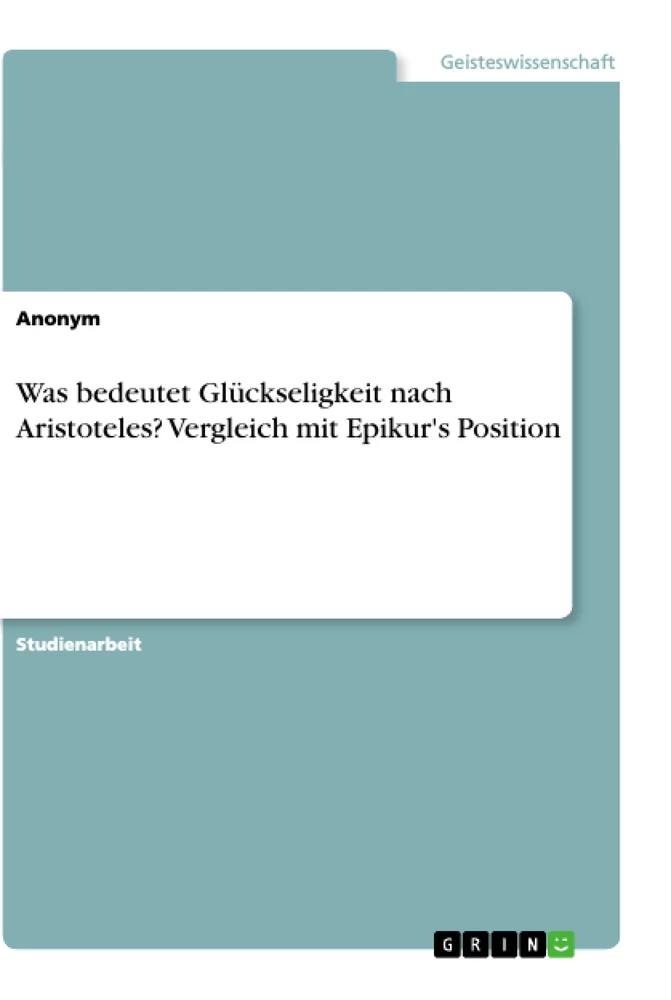
Seminararbeit , 2020 , 11 Seiten , Note: 1,5
Philosophie - Philosophie der Antike
Leseprobe & Details Blick ins Buch