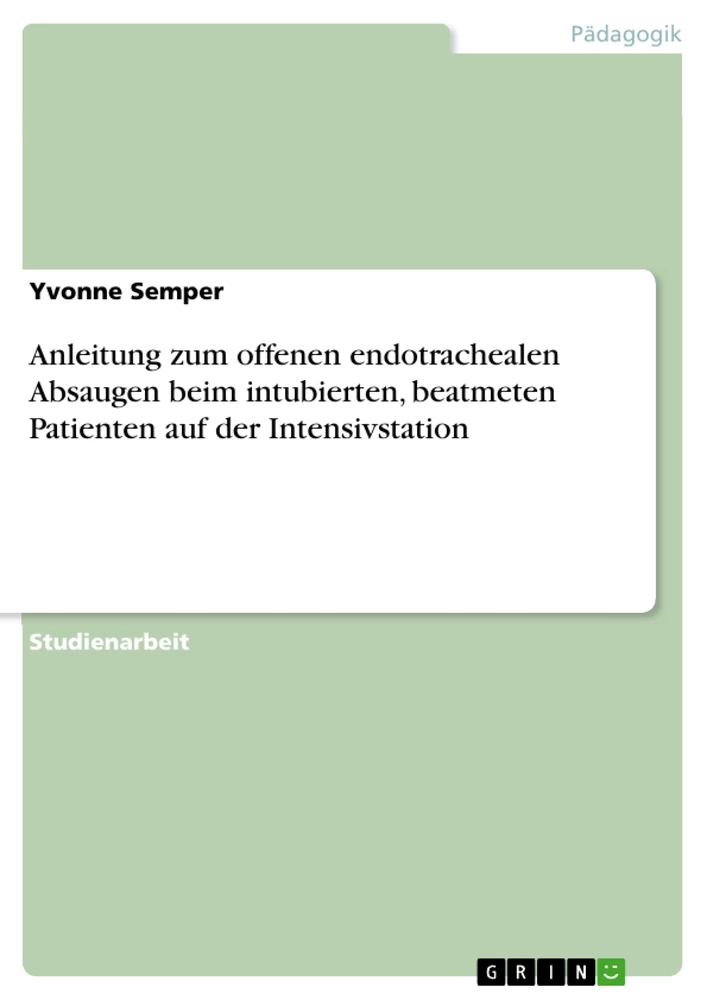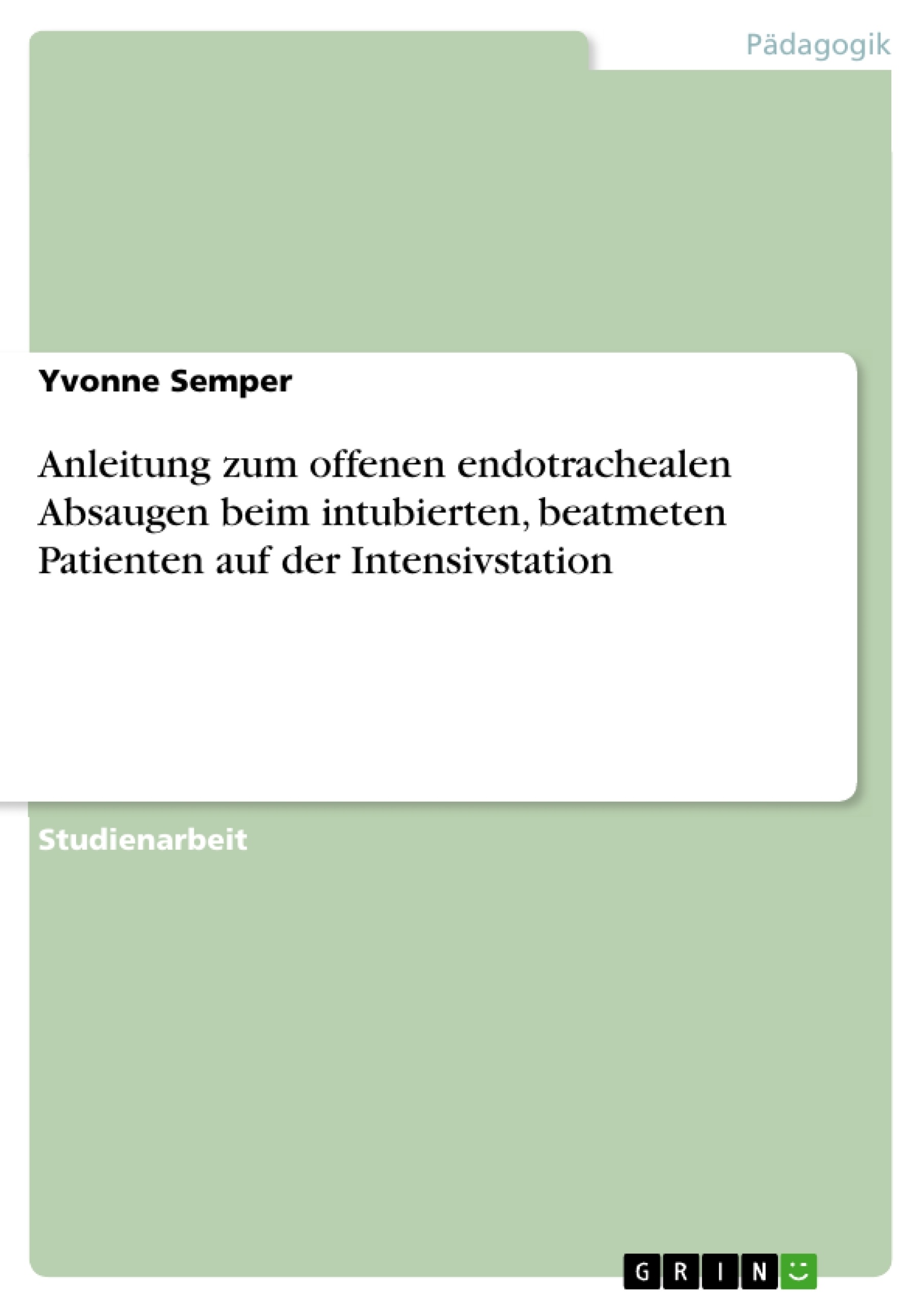Die Facharbeit befasst sich mit der Anleitungsplanung zur Thematik des offenen endotrachealen Absaugens beim intubierten, beatmeten Patienten im Setting der kardiochirurgischen Intensivstation. Zunächst erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem theoretischen Hintergrund zur Thematik. Den Ausführungen folgend wird die didaktische Analyse der geplanten Anleitung beschrieben und es werden unter anderem die Lernziele, das geplante methodische Vorgehen sowie die einzelnen Medien beleuchtet.
Patienten, die länger auf einer Intensivstation behandelt werden, sind häufig mit einem Endotrachealtubus oder einer Trachealkanüle versorgt. Das endotracheale Absaugen beim beatmeten Patient ist eine invasive Tätigkeit, die von Pflegekräften sicher beherrscht werden sollte. Dabei ist ein grundlegendes Wissen über Indikation, Durchführung und mögliche Gefahren der endotrachealen Absaugung obligat.
Die Pflegekräfte tragen bei Übernahme dieser Maßnahme die Durchführungsverantwortung. Im Notfall zum Beispiel bei Atemwegsverlegung durch Aspiration, müssen Pflegende in der Lage sein, diese lebensrettende Maßnahme sicher und kompetent auch ohne ärztliche Anordnung durchzuführen. Des Weiteren stellt der Absaugvorgang für den Patienten eine sehr unangenehme Maßnahme dar. Pflegende müssen durch professionelles Vorgehen Bedürfnisse des Patienten erkennen und für Sicherheit und Wohlbefinden während des Absaugvorgangs sorgen.
Inhaltverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2. Bedingungsanalyse
3. Sachanalyse
4. Didaktische Analyse
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Anhang