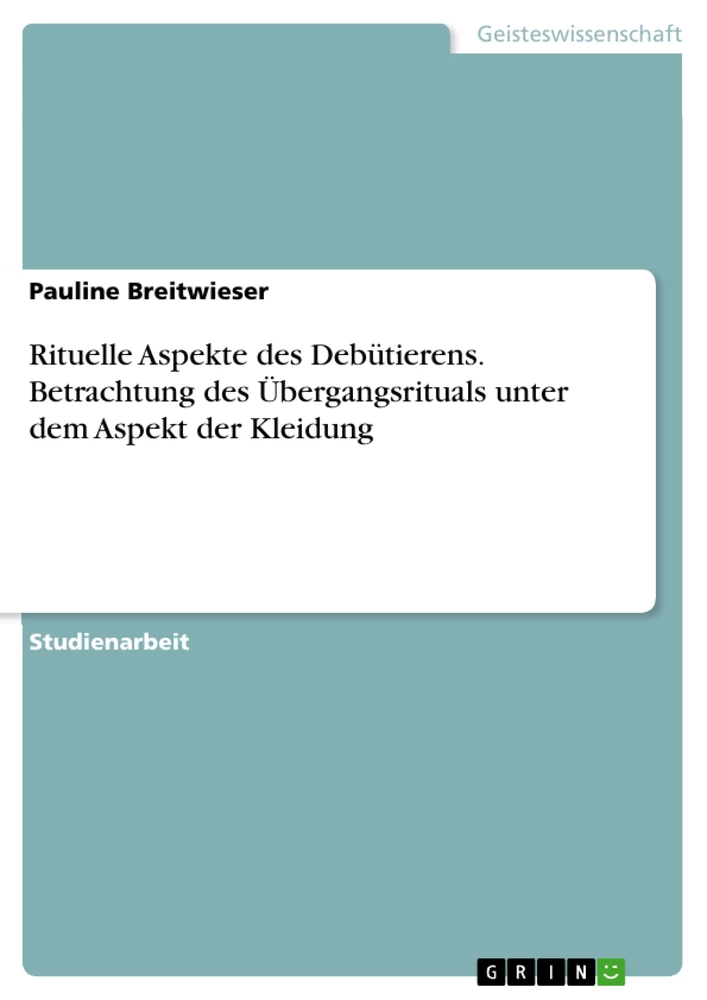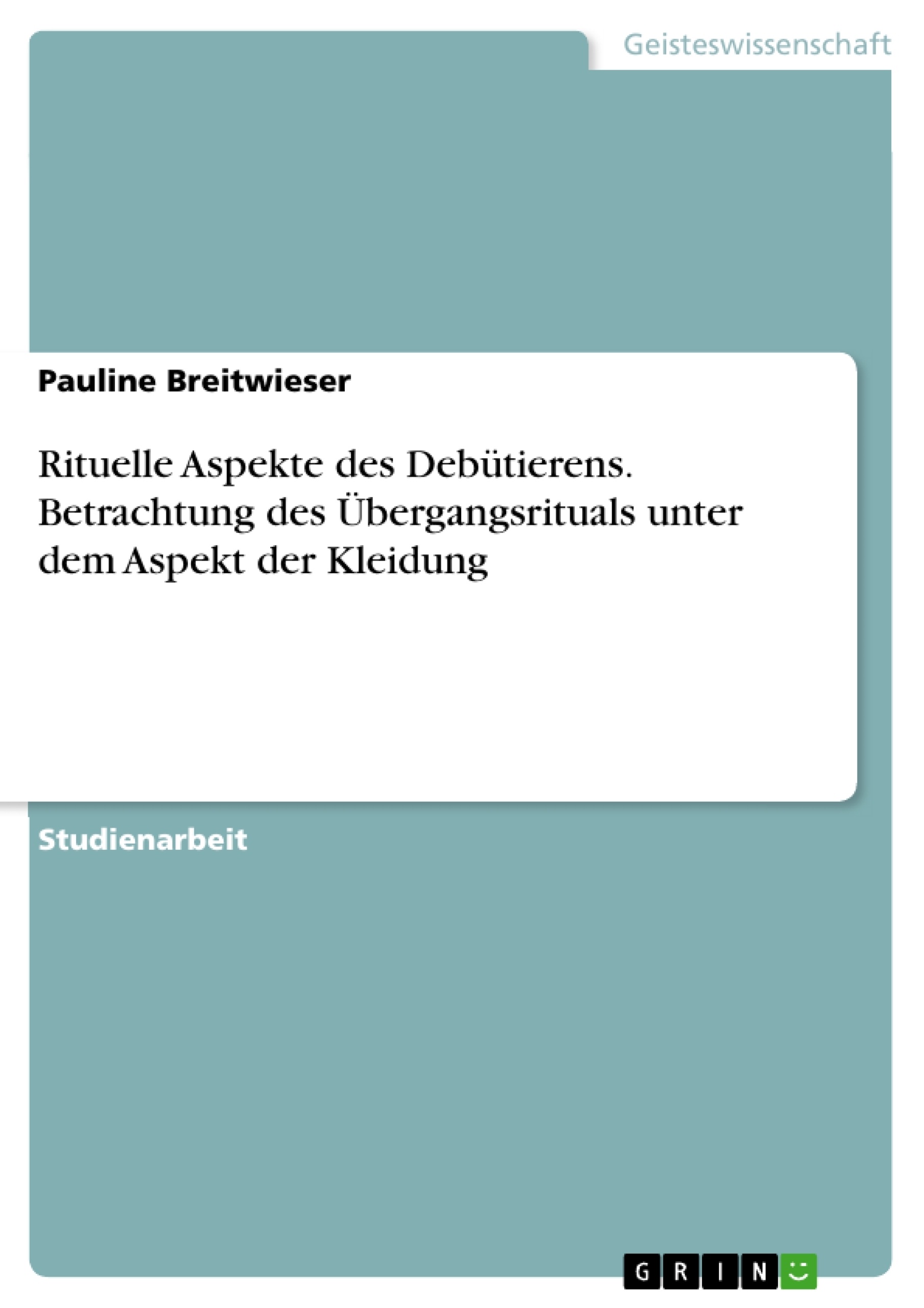Das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit liegt darin, eine Tradition, bzw. ein Ritual, das im 21. Jahrhundert etwas antiquiert wirkt, zu untersuchen. Es soll überprüft werden, inwiefern das Debütieren und insbesondere das Debütieren auf dem Wiener Opernball ein (Initiations-)Ritual ist und welche Rolle während dieses Prozesses die Kleidung darstellt. Dafür soll als erstes ein historischer Blick auf die Entwicklung des Balls bis hin zum Opernball heute geworfen werden und welcher Tradition das Debütieren zugrunde liegt. Im zweiten Teil der Arbeit soll eine definitorische Annäherung an den Forschungsgegenstand gemacht werden. Begriffe wie der des Rituals werden vor allem anhand der Theorien von Arnold van Gennep und Victor Turner genauer eingegrenzt, sowie die Ritualhaftigkeit des Debütierens anhand der Forschung der amerikanischen Kulturwissenschaftlerin Karal Ann Marling aufgezeigt. Die Kleidung von DebütantInnen soll in ihrer Bedeutsamkeit untersucht werden, um Rückschlüsse auf den Zusammenhang mit dem Ritual ziehen zu können.
Als Exemplifizierung werden aktuelle Vorgaben, Regelungen und Richtlinien für die DebütantInnen herangezogen. Um zusätzlich einen tieferen Einblick in die Schwellenphase des Rituals zu erhalten, werden einige Beiträge der Bloggerin HappyFace untersucht, die vor allem die Jungdamen während der Vorbereitungen auf ihren Auftritt begleitet hat. In der Forschungsliteratur findet sich erstaunlich wenig über das Debütieren an sich. Abgesehen von der bereits benannten Marling, die jedoch das Debütieren in den USA erforscht hat, gibt es nur knappe Ausführungen im Zusammenhang zu höfischer Kultur. Die folgende Arbeit möchte also hiermit einen kleinen Beitrag zur europäischen bzw. österreichischen "Debütierforschung" leisten.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Historischer Einblick und Begriffsbestimmung des Balls und des Debütierens
3 Definitorische Annäherung Initiationsritual
3.1 Debütieren als Initiationsritual
3.2 Kleidung als Teil des Rituals
4 Wiener Opernball als Erhaltungsrahmen des Debütierens
4.1 Debütieren am Wiener Opernball als Initiationsritual
4.2 Reglementierung Kleiderordnung
4.3 Liminalität bzw. Schwellenphase der DebütantInnen
5 Schlusswort
Quellen- und Literaturverzeichnis