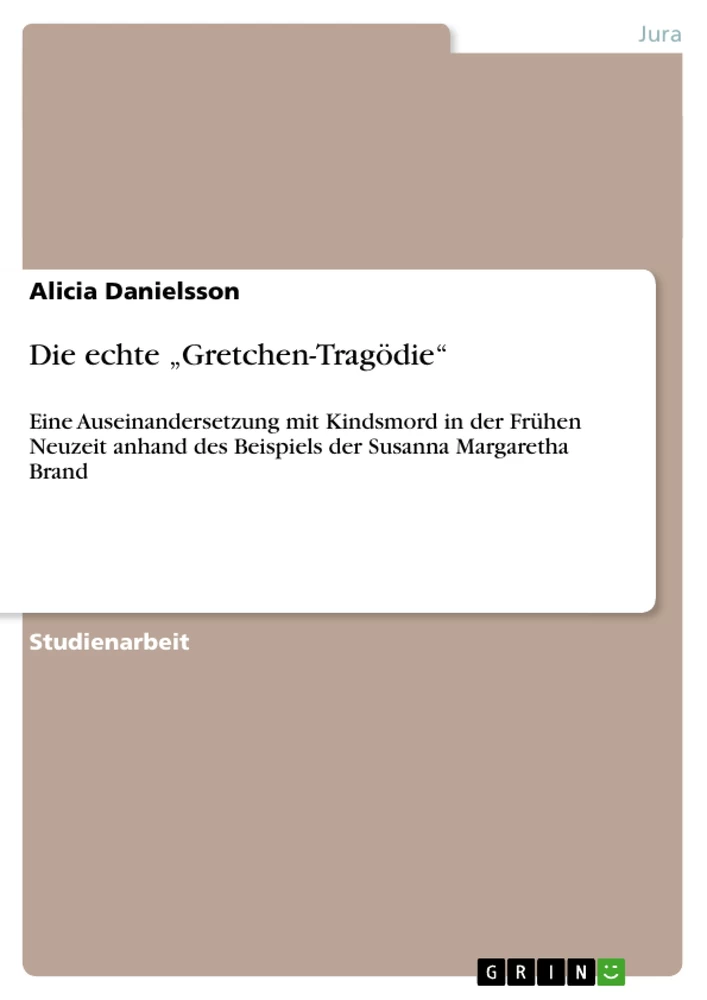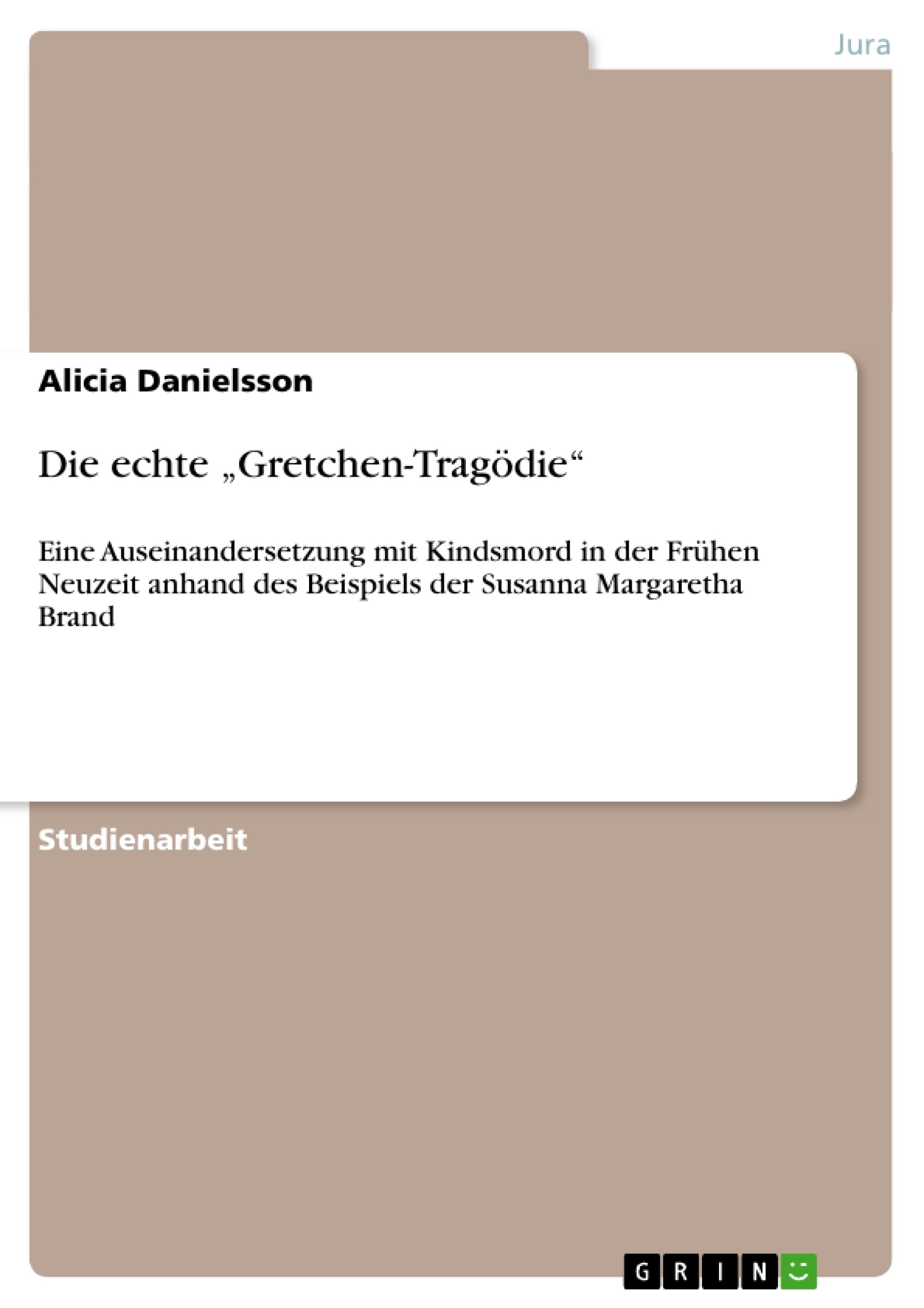„Sie hieß eigentlich nicht Gretchen. Der Name der Faust-Figur kommt zweifellos aus anderer Quelle. Aber Goethe legt seinem Gretchen Worte in den Mund, die sie gesprochen hat: Susanna Margaretha Brand, genannt Susann, die er hat sterben sehen Anfang 1772 und die niemand, der ihr begegnete jemals vergessen konnte…“ 1)
Dass den jungen Goethe diese Hinrichtung "so berührt hat", ist eine Legende, denn als Minister in Weimar hat er selbst ein Todesurteil über eine Kindsmörderin unterschrieben.
Ob dem wirklich so war, oder ob Goethe den Fall nur aus dem Grund verwendet hat, um sein Buch zu verkaufen, ist daher fraglich. Fakt ist jedoch, dass Goethe mit seinem Faust die Problematik seiner Zeit gut aufgefasst hat, um es an den Mann zu bringen. Zu der Zeit Goethes häuften sich solche Fälle, wie der von der Susanna Margaretha Brand. Immer mehr Frauen wurden unverheiratet schwanger und sahen daher Kindsmord als den einzigen Ausweg. Doch warum ist dies so? Was waren die Auslöser und wie handhabte man solche Fälle? Die Arbeit beginnt mit einem allgemeinen Überblick über das Thema des Kindermords in der Frühen Neuzeit. Anschließend wird der Sachverhalt anhand des Beispiels der Susanna Margaretha Brand dargestellt. Besonders hilfreich bei der Erstellung der Arbeit waren die Bücher „Gretchen – Ein Frankfurter Kriminalfall“ von Ruth Berger und „Das Frankfurter Gretchen“ von Rebekka Habermas.
1) Berger, Gretchen, S. 7
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Frankfurt im 18. Jahrhundert
2.1 Die Gesellschaft
2.2 Das Rechtswesen
2.2.1 Rechtsgrundlage
2.2.2 Die städtische Justiz
2.3 Rolle der Frau
2.3.1 In der Gesellschaft
2.3.2 Frauenkriminalität
2.3.3 Kindsmord
3 Darstellung am Beispiel des Falles der Susanna Margaretha Brandt
3.1 Zur Person
3.2 Der Vorfall
3.3 Der Prozess
3.3.1 Die Anklage
3.3.2 Die Verteidigung
3.4 Das Urteil
3.5 Die Hinrichtung
4 Auswirkung in der Literatur, Goethes „Faust “
5 Der Vergleich zu heute
5.1 Fall von heute
5.2 Fall in zweiter Instanz
6 Schluss
7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
„Sie hieß eigentlich nicht Gretchen. Der Name der Faust-Figur kommt zweifellos aus anderer Quelle. Aber Goethe legt seinem Gretchen Worte in den Mund, die sie gesprochen hat: Susanna Margaretha Brand, genannt Susann, die er hat sterben sehen Anfang 1772 und die niemand, der ihr begegnete jemals vergessen konnte…“[1]
Dass den jungen Goethe diese Hinrichtung "so berührt hat", ist eine Legende, denn als Minister in Weimar hat er selbst ein Todesurteil über eine Kindsmörderin unterschrieben.
Ob dem wirklich so war, oder ob Goethe den Fall nur aus dem Grund verwendet hat, um sein Buch zu verkaufen, ist daher fraglich. Fakt ist jedoch, dass Goethe mit seinem Faust die Problematik seiner Zeit gut aufgefasst hat, um es an den Mann zu bringen. Zu der Zeit Goethes häuften sich solche Fälle, wie der von der Susanna Margaretha Brand. Immer mehr Frauen wurden unverheiratet schwanger und sahen daher Kindsmord als den einzigen Ausweg. Doch warum ist dies so? Was waren die Auslöser und wie handhabte man solche Fälle? Die Arbeit beginnt mit einem allgemeinen Überblick über das Thema des Kindermords in der Frühen Neuzeit. Anschließend wird der Sachverhalt anhand des Beispiels der Susanna Margaretha Brand dargestellt. Besonders hilfreich bei der Erstellung der Arbeit waren die Bücher „Gretchen – Ein Frankfurter Kriminalfall“ von Ruth Berger und „Das Frankfurter Gretchen“ von Rebekka Habermas.
2 Frankfurt im 18. Jahrhundert
2.1 Die Gesellschaft
Die frühneuzeitliche Gesellschaft Europas gliederte sich in mehrere Stände. Das Ständesystem war ein gesellschaftliches Ordnungsmodell, mit einer geringen sozialen Mobilität. Standesgrenzen bestanden vor allem auf Grund unterschiedlicher Herkunft.
An der Spitze der Gesellschaft stand das Patriziat, das aus etwa 24 alteingesessenen Familien bestand und im städtischen Rat mehrheitlich die erste Bank besetzte und damit über den größten Einfluss verfügte. Hiernach folgten die reichen Stadtbürger. Dazu zählten unter anderem Kaufleute, Bankiers und Juristen. Diese waren häufig genauso vermögend wie die Patrizier, aber, da sie weitgehend auf die mit geringerer Macht verbundene zweite Bank beschränkt blieben, hatten sie weniger Einfluss. Eine bekannte Familie, die zu diesem Stand gehörte, war die Familie Goethe.
An nächster Stelle und deutlich von diesen beiden Ständen geschiedene Gruppe stellte die Handwerkerschaft dar. Sie war zwar im Rat vertreten, aber aufgrund ihrer Beschränkung auf die dritte Bank konnten sie keine Führungspositionen besetzen.
Die überwältigende Mehrheit von etwa 40 000 Einwohnern bestand aus der großen heterogenen Gruppe derjenigen, die keinem Handwerk angehörten und sich als Mägde, Tagelöhner, und in niedrigen städtischen Diensten, als Gelegenheitsarbeiter und Handlanger ihren Unterhalt verdienten. Sie hatten kein Bürgerrecht und daher keinen Sitz im Rat.
Ebenfalls von der politischen Partizipation ausgeschlossen waren die Menschen, die der großen jüdischen Gemeinde angehörten.[2]
2.2 Das Rechtswesen
Das Rechtswesen der frühen Neuzeit kann als Übergang vom Mittelalter zur heutigen Zeit angesehen werden.
2.2.1 Rechtsgrundlage
Das Strafverfahren wurde lange Zeit durch die Rechtszersplitterung von Willkür beherrscht. Die bestehenden Probleme schienen nur durch eine konsequente und für den Bürger verständliche Rechtssprechung lösbar zu sein. Daher wurde die Constitutio Criminalis Carolina 1532, um eine Vereinheitlichung des Rechts im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zu schaffen, eingeführt.
Die Constitutio Criminalis Carolina (CCC) gilt heute als erstes allgemeines Deutsches Strafgesetzbuch. Sie ist auch als „Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532“ bekannt und basiert auf die 1507 von Johann Freiherr von Schwarzenberg verfasste Halsgerichtsordnung von Bamberg. Diese griff bereits auf das Römische Recht zurück.
Die CCC befasste sich mit strafwürdigen Verbrechen wie Mord, Totschlag, Räuberei, Brandstiftung und Zauberei.[3]
2.2.2 Die städtische Justiz
In der städtischen Justiz waren Prozesse geheim und schriftlich. Es gab keine Trennung in Staatsanwaltschaft, Richter und Verteidiger.
Es gab jedoch vier Gremien für den Ablauf eines Falles. Das erste Gremium war die Bürgermeisteraudienz. Hier hörte man sich die Anklage an und leitete erste Untersuchungsschritte ein. Das zweite Gremium war das Peinliche Verhöramt, welches in Absprache mit dem Schöffenrat und dem Rat die Ermittlungen gegen den Angeklagten führte. Das Peinliche Verhöramt bestand aus dem jüngeren Bürgermeister, einem rechtsgelehrten Ratsherrn der zweiten Bank und dem Ratsschreiber. Der Ratsschreiber war für die Verhöre außerhalb des Verhöramts zuständig.
Das dritte Gremium bestand aus den Syndikern. Diese überprüften, ob das Peinliche Verhöramt alle zur Überführung eines Täters wichtigen Schritte eingeleitet hatte. Die Angeklagten bekamen sie nie zu Gesicht. Das Besondere an diesem Gremium war, dass es nicht aus einer Gruppe von Ratsfamilienmitgliedern bestand. Man versuchte hiermit eine Verbindung zum Rat zu vermeiden. Die Syndiker sollten unabhängig von „Freundschaft, Feindschaft, Hass, Geschmack, oder Gaben“[4] urteilen können.
Das vierte und wichtigste Gremium war der Rat. Dieser entschied, ob den Ratschlägen der Syndiker zu folgen sei oder nicht.
Nachdem den Vorschlägen nachgekommen und die Ermittlungen dadurch vorerst abgeschlossen waren, bestellen sie einen Verteidiger, dem alle im Verhöramt sorgfältig geordneten und aufbewahrten Akten des Falls übergeben wurden, damit er eine Verteidigungsschrift fertigen konnte.
Der Verteidiger hatte die Möglichkeit das Verhöramt um weitere Ermittlungen zu bitten oder Anträge der Angeklagten vorzutragen.
Das endgültige Urteil wurde schließlich von den Syndikern gefällt.[5]
2.3 Rolle der Frau
2.3.1 In der Gesellschaft
In erster Linie bestand die Rolle der Frau in der Gesellschaft darin, dass sie gute Ehefrauen und Mütter sein sollten.
Daher war es sehr wichtig für eine Frau möglichst vorteilhaft zu heiraten, um eine solide Lebensgrundlage für sich zu schaffen. Zusätzlich trug eine vorteilhafte Heirat zum Ansehen der Familie bei.
[...]
[1] Berger, Gretchen,
[2] Habermas, Das Frankfurter Gretchen, S. 8 f.
[3] Reclam, Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532, S. 4 ff.
[4] IfSG Rats- und Ämterwahlen Nr. 75, Dienstbrief Nr.545 Wilhelm Freidrich Lanz, zitiert nach Habermas, Das Frankfurter Gretchen,
[5] Habermas, Das Frankfurter Gretchen, S. 22 ff.