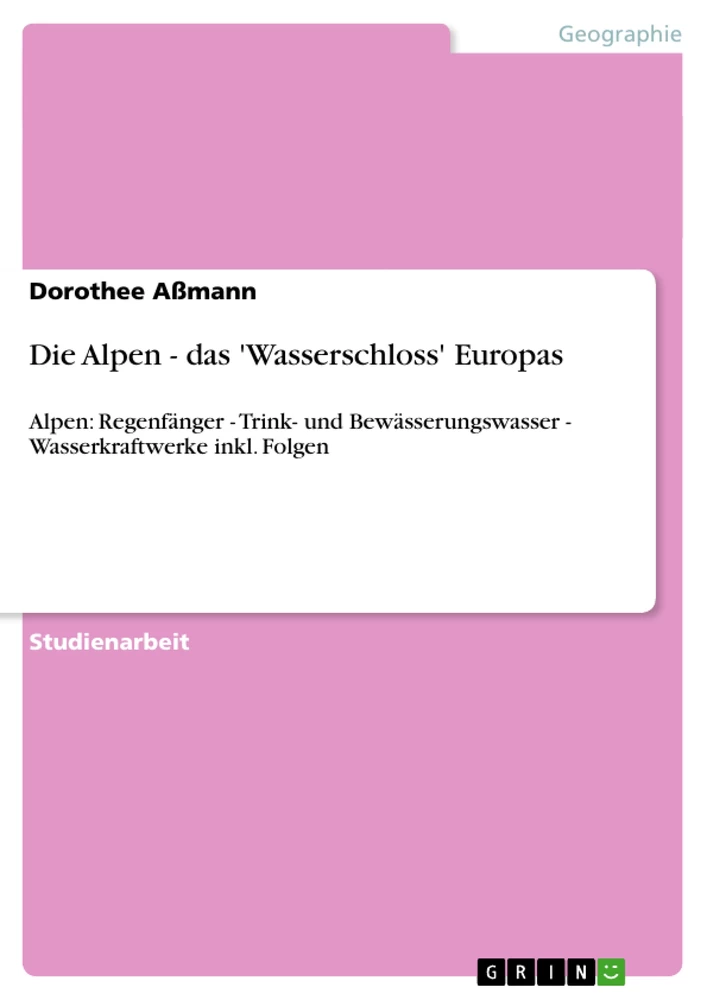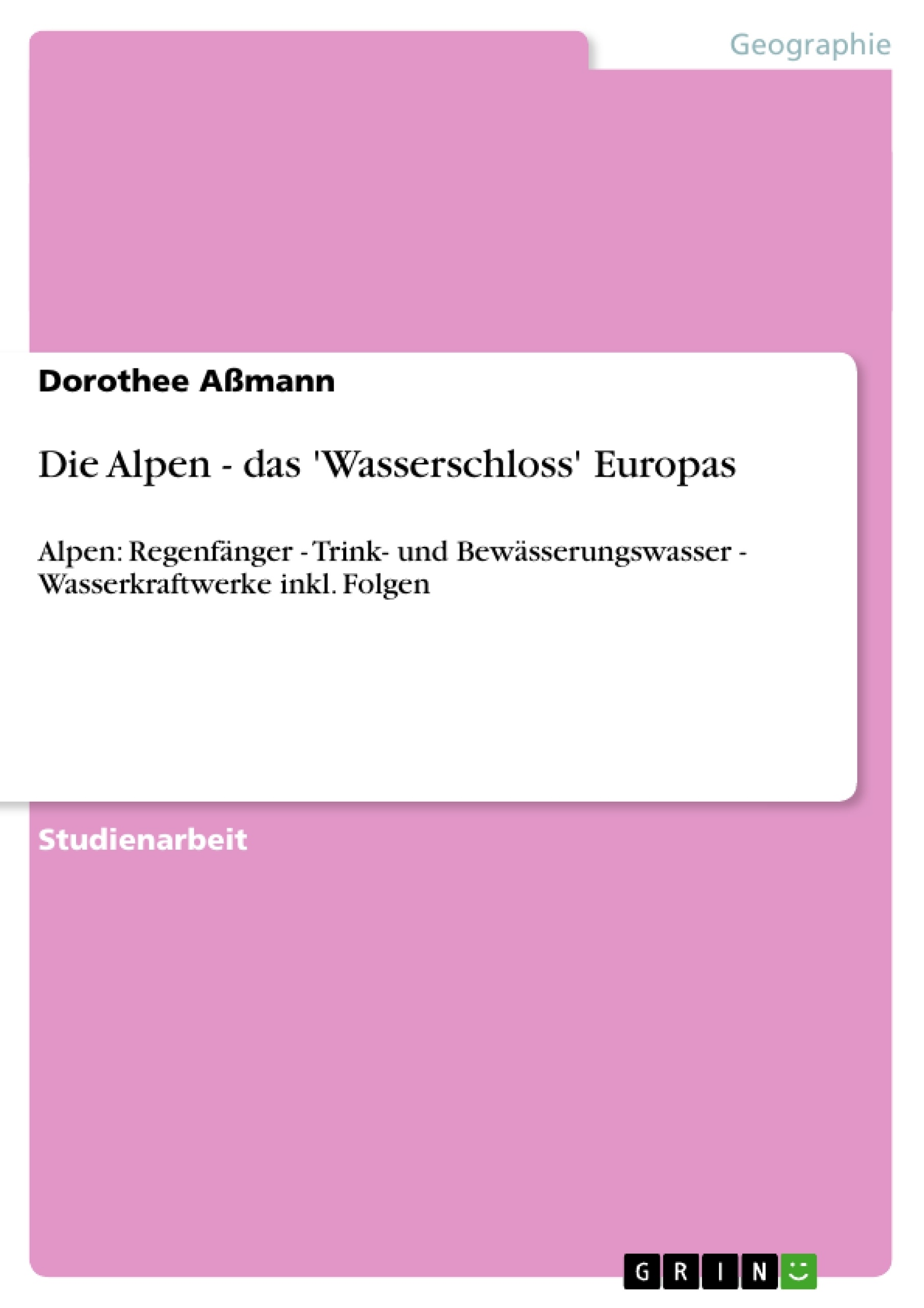Wasser ist eine der kostbarsten natürlichen Ressourcen, die es auf der Welt gibt.
Dies klingt merkwürdig, wenn man bedenkt, dass 70 Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt ist. Die verfügbare Gesamtwassermenge wird auf rund 1,4 Milliarden km³ errechnet. 97,8 Prozent davon befindet sich als Salzwasser im Weltozean.
Auch die vielfältigen Funktionen des Wassers lassen vermuten, dass Wasser im Überfluss vorhanden ist: Wasser dient als Lebensraum, ist Lebensgrundlage, dient dem Transport, wird als Deponie genutzt, hat Klima regulierende Eigenschaften und vieles mehr. Die in der Siedlungswasserwirtschaft nutzbare Menge an Wasser, das Süßwasser, beträgt jedoch nur ca. 2,2 Prozent der Gesamtwassermenge. Diese verteilen sich mit abnehmender Menge auf das ...
Inhaltverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Alpen als regenfänger
3 Trink- und bewässerungswasser
3.1 Wasserleitungen
4 Wasserkraftwerke
4.1 Laufkraftwerke
4.2 Speicherkraftwerke
4.3 Die Quantitative Dimension der Wasserkraft
4.4 Arbeitsplätze und Wasserzinsen
4.5 Umweltprobleme
5 Ausblick
6 LITERATURVERZEICHNIs
Die Alpen – das ‚Wasserschloss’ Europas
1 Einführung
Wasser ist eine der kostbarsten natürlichen Ressourcen, die es auf der Welt gibt.
Dies klingt merkwürdig, wenn man bedenkt, dass 70 Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt ist. Die verfügbare Gesamtwassermenge wird auf rund 1,4 Milliarden km³ errechnet. 97,8 Prozent davon befindet sich als Salzwasser im Weltozean.
Auch die vielfältigen Funktionen des Wassers lassen vermuten, dass Wasser im Überfluss vorhanden ist: Wasser dient als Lebensraum, ist Lebensgrundlage, dient dem Transport, wird als Deponie genutzt, hat Klima regulierende Eigenschaften und vieles mehr. Die in der Siedlungswasserwirtschaft nutzbare Menge an Wasser, das Süßwasser, beträgt jedoch nur ca. 2,2 Prozent der Gesamtwassermenge. Diese verteilen sich mit abnehmender Menge auf das Gletschereis, das Grundwasser, die Seen und auf die Atmosphäre sowie auf Flüsse.[1]
Im Zuge der Industrialisierung stieg der Wasserverbrauch in den letzten Jahrhunderten stetig an, da bei der Industrieproduktion und der industrialisierten Landwirtschaft sehr viel Wasser gebraucht wird. Mit dem modernen Lebensstandard unserer heutigen Dienstleistungsgesellschaft hat sich der Nutz- und Trinkwasserverbrauch pro Kopf oder Haushalt ebenso in die Höhe bewegt. Zudem spielt die Elektrizitätsgewinnung aus Wasserkraft ab dem Ende des 19. Jahrhunderts eine relative Rolle in den Volkswirtschaften Europas.
Während im feuchten West-, Nord- und Mitteleuropa auf der Nordseite der Alpen bisher kaum jemals Probleme mit der Wasserversorgung zu befürchten waren, bekommen die Bewohner der sommertrockenen Länder Süd- und Südosteuropa die Wasserknappheit des Öfteren zu spüren.[2]
2 Die Alpen als Regenfänger
Der hohe Gebirgskörper der Alpen stellt für die Wolken eine natürliche Barriere da. Die feuchten Luftmassen stauen sich vor dem Gebirgsmassiv auf und werden zum Aufsteigen gebracht. Dabei kommt es zwangsläufig zu einem Abregnen. Aufgrund der in Westeuropa vorherrschenden Westwinde erfolgt dieser Vorgang überwiegend an der Nordseite der Alpen. An manchen Tagen findet dieser Vorgang jedoch auch an der Südseite der Alpen statt. Die trockenadiabatische Luft, die nach dem Abregnen über den Gebirgskamm als warmer Fallwind auf die Nordseite des Gebirges bläst, wird als Föhn bezeichnet.
Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge liegt in Europa bei 660 mm. In den Alpen sind es mit 1450 mm mehr als doppelt so viel. Doch während in Europa 44 Prozent des Niederschlags durch Verdunstung an die Atmosphäre abgegeben werden, verdunsten im Gebiet der Alpen lediglich 37 Prozent. Die restlichen 910 mm fließen ab.
Der Grund für die geringe Verdunstungsmenge basiert auf der topographischen, exponierten Lage viele Meter über dem Meeresspiegel. Aufgrund der geringeren Lufttemperatur und -dichte kann weniger Wasser pro Kubikmeter Luft gebunden werden.
Übermäßige Abfluss – Schwankungen sind in den Alpen nicht zu befürchten, da die alpinen Gletscher etwa die Niederschlagsmenge eines ganzen Jahres in Form von Eis speichern. Die vielen (Alpenrand)Seen sorgen zusätzlich für einen stabilen Wasserhaushalt, sodass der Wasserabfluss aus den Alpen jährlich rund 216 200 Mio. m³ Wasser beträgt.
Die Bedeutung der Alpen als Wasserschloss Europas stützt sich also nicht nur auf die hohen Niederschlagsmengen, sondern auch auf die niedrige Verdunstungsbilanz sowie auf die gespeicherten Wasservorkommen im Eis und zahlreichen Seen.
Dieses besondere Potenzial wurde ab 1890 im großen Rahmen nutzbar gemacht. Die Nutznießer waren jedoch überwiegend außeralpine Räume, während der Alpenraum an sich von der Nutzung seiner Ressourcen wenige Vorteile hat.
Auch Adolf Hitler sah die immense Bedeutung, die der Gebirgsraum wegen seiner naturräumlichen Voraussetzungen u. a. für die Wasserkraftnutzung darstellte. Nach dem Bau der Tauernkraftwerke und einer riesigen Staumauer im Ötztal wollte dieser nach dem ‚Endsieg’ zahlreiche Täler fluten lassen, um die Leistungen der Kraftwerke nochmals zu steigern.[3]
[...]
[1] Ahnert, F. (1999): Einführung in die Geomorphologie. Stuttgart. S. 175.
[2] Bätzing, W. (2003), S.190.
[3] Ebd. S. 190f.