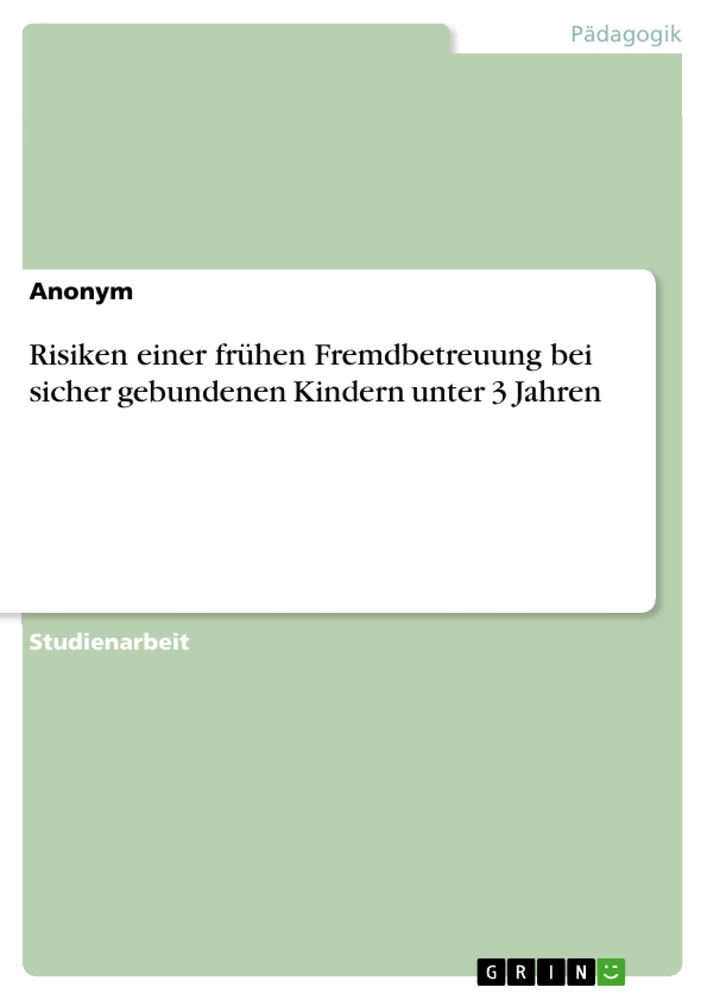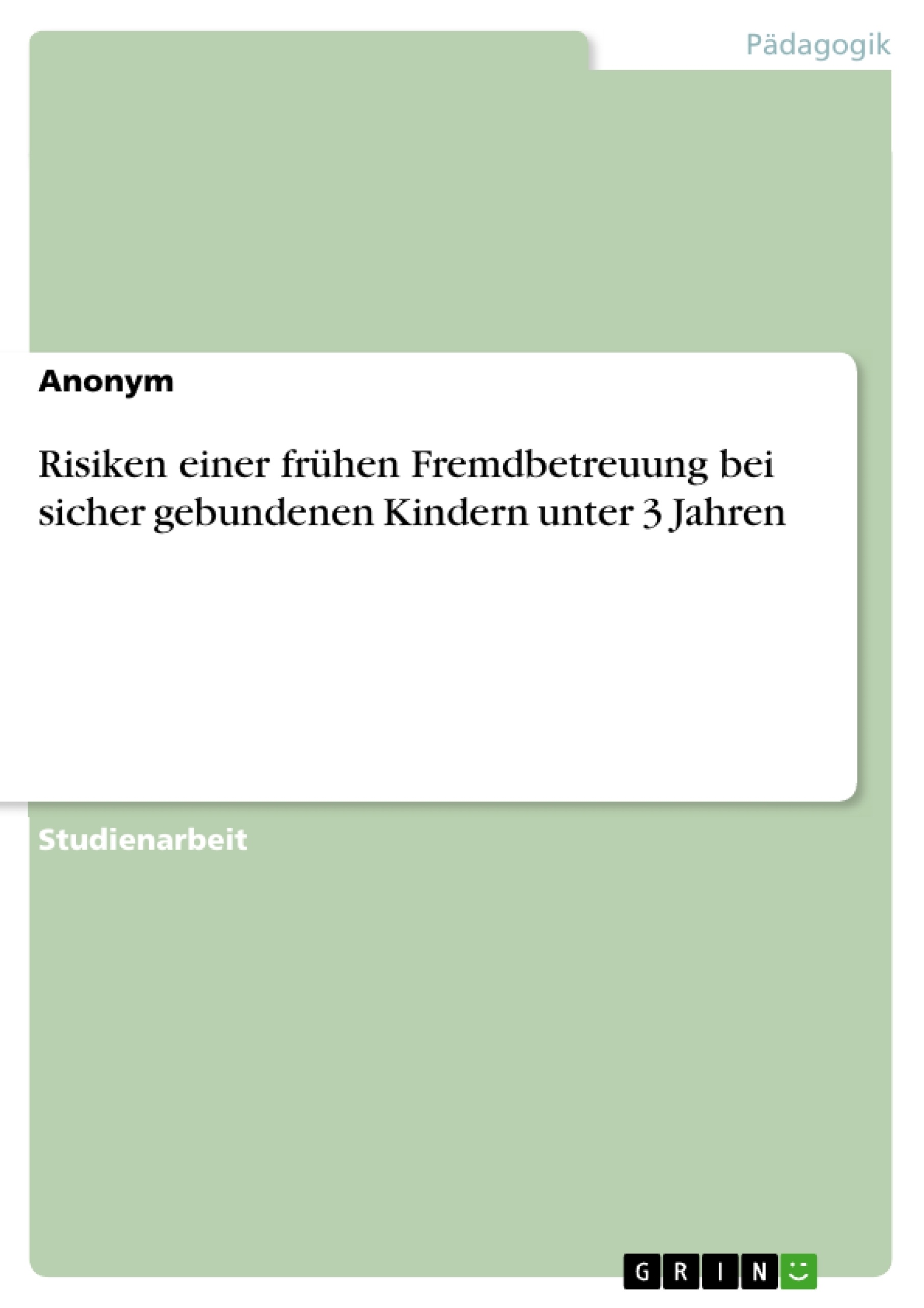Jeder Mensch hat ein Grundbedürfnis nach menschlicher Nähe und Zuwendung, d. h. nach Bindung. Dieses Bedürfnis ist von Geburt an vorhanden und schon hier bzw. auch schon pränatal, werden die Grundsteine einer sicheren Bindung gelegt. Es ist noch nicht sehr lange her, da wurde der Bindung als grundlegende Basis der zwischenmenschlichen und psychischen Befindlichkeit eines Menschen kaum Beachtung geschenkt. Erst mit Einführung der Bindungstheorie in die wissenschaftliche Psychologie durch John Bowlby und Mary Ainsworth ab den 1950er Jahren fand eine Veränderung statt. In früheren Jahren noch war es üblich ein Kind die ersten drei Jahre zuhause von der Mutter betreuen zu lassen. Da in unserer heutigen Zeit viele Eltern darauf angewiesen sind, oder es gerne möchten, schnell nach der Geburt eines Kindes wieder arbeiten zu gehen, werden in Deutschland derzeit 34,3% aller unter Dreijährigen fremd betreut.
Doch beschäftigt man sich im Rahmen der Bindungsforschung mit Kindern im Alter von 0-3 Jahren, wird man sehen, dass die Bindung zu den Eltern im Laufe des ersten Lebensjahres entsteht und das Kind in dieser Zeit ganz auf sich und seine Eltern bezogen ist. Erst mit ca. drei Jahren ist es in der Lage aufeinander bezogene wechselseitige Beziehungen zu mehreren Bindungspersonen entstehen zu lassen. Aufgrund eigener Erfahrungen in der Kindheit, sowie mit den eigenen Kindern, stellt sich hier die Frage: Welche Risiken kann eine frühe Fremdbetreuung – hier speziell für sicher gebundene Kinder unter 3 Jahren – in Bezug auf die kindliche Entwicklung und die Eltern-Kind-Bindung mit sich bringen und worauf ist in der Kita-Eingewöhnung zu achten, um eventuelle Risiken möglichst zu vermeiden?
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitu
2 Bindungstheoretische Grundüberlegun
2.1 Die Bindungstheorie
3 Sichere Bind
3.1 Phasen der Bindungsentwicklung
3.2 Erste Bindung an die Mutter und die Bedeutung der Vater-Kind-Bindung
4 Frühe Fremdbetreu
4.1 Risiken einer frühen Fremdbetreuung
4.2 Mögliches Vorgehen bei der Eingewöhnung
4.3 Rahmenbedingungen für eine gelungene Eingewöhnung und Fremdbetreuung
4.4 Kennzeichen einer gelungenen Eingewöhnung
5 Fazi
Literatur- und Quellenverzeichni
Anhan