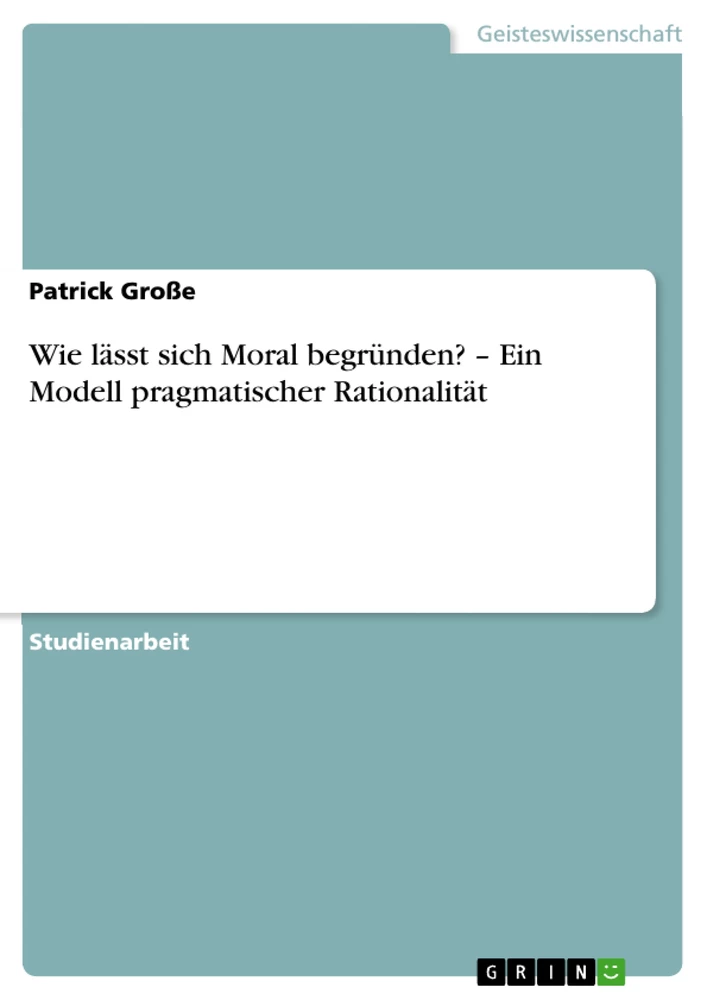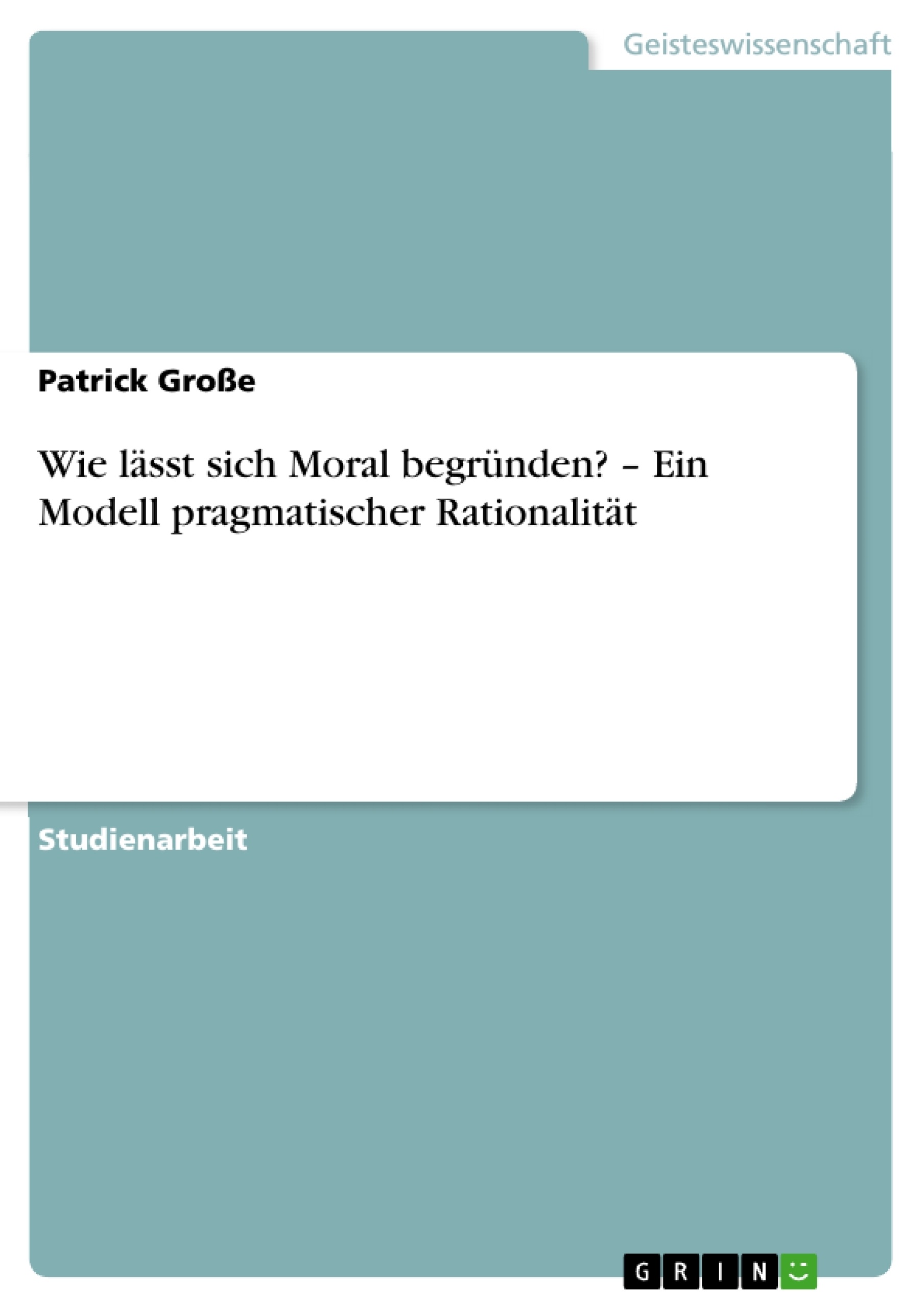1. Die wissenschaftliche Aufgabe der Moralphilosophie: Begründungen finden
In dieser Arbeit möchte ich mich mit dem Thema der Moralphilosophie beschäftigen, um so einen Vorschlag zur Begründung von Moral zu erarbeiten, der nicht nur auf natürliche Grundlagen des menschlichen Wesens zurückgreift, sondern auch die Rationalität als Grund für gemeinschaftsförderliche Handlungen annimmt.
Nachdem die Rolle der Philosophie im Kampf um eine Moralbegründung verdeutlicht wurde, gehe ich zunächst zur Begründungsfrage nach dem ‚Warum’ über. Im Zuge der ersten Überlegungen zur Moralbegründung im Allgemeinen, bot sich ein grundlegender Skeptizismus an, der gegenüber allen menschlichen Gebilden, Erfindungen und Gedankengängen nicht mit kritischer Aufmerksamkeit spart. Sodann stellte sich mir die Frage, was diesen Skeptizismus begründet. So kam ich zu dem Schluss, die These zu formulieren, dass der Mensch ein Individuum in der Gesellschaft ist und die Moral als Mittel für ein möglichst erträgliches Zusammenleben gilt. [...]
Um die Erfahrungswissenschaften (empirische Wissenschaften) zu stärken, stützt sich mein Vorschlag zur Moralbegründung in weiten Teilen darauf, was die naturalistische Ethik auf den Plan ruft. Diese Position möchte ich dann darlegen, indem der Begriff der Moral geklärt und grundsätzlich festgehalten wird: der Mensch ist in erster Linie notwendig ein biologisches Wesen aus Fleisch und Blut. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Die wissenschaftliche Aufgabe der Moralphilosophie: Begründungen finden
1.1 „Felix, qui potuit rerum cognoscere causas.“ – moralphilosophische Geltungsansprüche
1.2 Der erkenntnistheoretische Anthropozentrismus als Ausgangsbasis von moralischen Begründungsversuchen
2. Begründungsansätze für Moral
2.1 Kants deontologischer Begründungsversuch – eine normative Ethik
2.2 Der pragmatische Begründungsversuch – ein moralisches Gefühl
3. Die naturalistische Ethik – soziobiologische Grundlagen und moralischer
Anspruch
3.1 Rationalitätsansprüche und Moralkriterien
3.2 Der Mensch – ein Individuum im Gemeinwesen
3.3 Versuch einer Abgrenzung zu Foot und McDowell
4. Die Fähigkeit moralischer Abstraktion – ein naturalistisches Modell pragmatischer Moralbegründung
5. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Die wissenschaftliche Aufgabe der Moralphilosophie: Begründungen finden
In dieser Arbeit möchte ich mich mit dem Thema der Moralphilosophie beschäftigen, um so einen Vorschlag zur Begründung von Moral zu erarbeiten, der nicht nur auf natürliche Grundlagen des menschlichen Wesens zurückgreift, sondern auch die Rationalität als Grund für gemeinschaftsförderliche Handlungen annimmt.
Nachdem die Rolle der Philosophie im Kampf um eine Moralbegründung verdeutlicht wurde, gehe ich zunächst zur Begründungsfrage nach dem ‚Warum’ über. Im Zuge der ersten Überlegungen zur Moralbegründung im Allgemeinen, bot sich ein grundlegender Skeptizismus an, der gegenüber allen menschlichen Gebilden, Erfindungen und Gedankengängen nicht mit kritischer Aufmerksamkeit spart. Sodann stellte sich mir die Frage, was diesen Skeptizismus begründet. So kam ich zu dem Schluss, die These zu formulieren, dass der Mensch ein Individuum in der Gesellschaft ist und die Moral als Mittel für ein möglichst erträgliches Zusammenleben gilt.
Ich werde dann das dieser Arbeit zugrunde liegende Menschenbild in Ansätzen klären und wende mich dem erkenntnistheoretischen Anthropozentrismus zu, der den wohl plausibelsten Ausgangspunkt der folgenden Argumentation bietet.
Um die oben aufgeführte These einer Kritik auszusetzen, gebe ich die normative Ethik, vertreten durch Immanuel Kant und die empathisch-pragmatische Auffassung von Moralbegründung, an. Da ich mich aber bereits im Vorfeld stark mit einer naturalistischen Ethik angefreundet habe, unterziehe ich die kantischen und pragmatischen Begründungsbemühungen sogleich einer Gegenkritik, die zeigen soll, dass auch diese Vertreter keine endgültige Begründung für Moralität gefunden haben.
Um die Erfahrungswissenschaften (empirische Wissenschaften) zu stärken, stützt sich mein Vorschlag zur Moralbegründung in weiten Teilen darauf, was die naturalistische Ethik auf den Plan ruft. Diese Position möchte ich dann darlegen, indem der Begriff der Moral geklärt und grundsätzlich festgehalten wird: der Mensch ist in erster Linie notwendig ein biologisches Wesen aus Fleisch und Blut.
Da die naturalistische Position bereits von Autoren wie Philippa Foot vertreten wurde, werde ich meinen pragmatischen Vorschlag zur Moralbegründung von ihrem abgrenzen und dadurch gleichzeitig deutlicher werden lassen.
Den letzten Teil dieser Arbeit wird dann die Darstellung des Vorschlags, die Fähigkeit moralischer Abstraktion – als naturalistisches Modell pragmatischer Moralbegründung, beanspruchen.
1.1 „Felix, qui potuit rerum cognoscere causas.“ - moralphilosophische Geltungsansprüche
Philosophie[1] kann einerseits als eine Art Tatbestand verstanden werden, in dem die Erkenntnisse des Zusammenhangs der Dinge in der Welt aus den letzten Jahrtausenden z.B. in Theorieform gebracht wurden[2]. Den weitaus wichtigeren Zugang zur Philosophie bildet allerdings das Philosophieren selbst. Hier ist das Streben nach Erkenntnissen als Tätigkeit gemeint[3], das durch die grundlegenden methodischen Vorgehensweisen der Analyse und Synthese charakterisiert wird[4]. Als Grundlagenwissenschaft der analytischen Fähigkeit des menschlichen Geistes nimmt die Philosophie einen Platz in der Wissenschaft ein, der sich sowohl als Segen, denn auch als Fluch herausstellt. Alle Fragen können unendlich weitreichend konkretisiert werden, so dass am Ende immer ein ahnungsloses Schulternzucken oder ein verwirrter Blick des Gegenübers zurückbleibt. Die Einzelwissenschaften hingegen, wie z.B. die Mathematik, können innerhalb ihrer streng definierten Grenzen Antworten auf ebenso streng definierte Fragen geben. So kann die Addition zweier natürlicher Zahlen durchaus Beantwortung durch die Benennung einer Ziffer finden Jedoch scheitert die Einzelwissenschaft der Mathematik an der Frage: Warum entsteht diese Ziffer und aus welchem Grund bedient man sich dabei des terminus technicus der Addition?![5] Eine Begründung der Bedeutung des Begriffs der Addition kann eine Einzelwissenschaft wie die Mathematik – ohne philosophische Prämissen – nicht liefern.
Diese elementarste aller Fragen nach dem Warum stellt nicht nur innerhalb eines vordefinierten Systems Herausforderungen dar, sondern ist Ausdruck eines tief greifenden Skeptizismus gegenüber allen Konstrukten menschlicher Erfindungen und Fähigkeiten. Da alle Einzel- bzw. Erfahrungswissenschaften nicht über ihren selbst gesetzten Horizont der Erkenntnis hinausgehen (können), sehr wohl aber das menschliche Denken viel weitere und komplexere Kreise über die Erkenntnis der Welt zu ziehen vermag und nach Neugierbefriedigung strebt, kann nur die Philosophie Werkzeuge bereitstellen, die dem bestrebten Denken des Menschen angemessen sind und sowohl adäquate wie auch befriedigende Antworten bieten kann.
„[…] Da es der Philosophie allerdings nicht möglich ist, die Begründungen ihrer eigenen Voraussetzungen in nicht-philosophische Voraussetzungen zu begründen, bleibt als einzig denkbare Möglichkeit der Begründung letzter Voraussetzung, daß die Voraussetzungen der Philosophie den Grund ihrer Geltung in sich selbst finden: […] (die) Erkenntnis zu enthüllen [(Analyse)] und […] zu bestimmen [(Synthese)].“[6]
Wir Menschen versuchen ständig, unser Denken und Handeln zu rechtfertigen, um so die Frage nach dem ‚Warum’ erträglich zu gestalten und sinnvolle (plausible) Antworten zu geben. Dabei ist das Angeben von Gründen eine wichtige Aufgabe, die durch analytisches Denken Bearbeitung finden kann. Betrachtet man den Menschen als Individuum und gleichzeitig als Teil der Gemeinschaft, so stellt sich die Frage, ‚Warum’ der einzelne Mensch bzw. Menschengruppen so handeln wie sie handeln. Hiermit wird nun das Feld der Moral betreten.
„Für den Bereich der Moral hat sich die Ethik oder Moralphilosophie als zuständige Disziplin herausgebildet. Sie versucht, für moralische Urteile, Handlungen und Argumentationsmuster eine Systematik zu entwickeln […]“[7].
Wenn das Ethische herausgegriffen wird, bedarf es bestimmter Maßstäbe und / oder Prinzipien,
„[…] die es uns ermöglichen, eine bestimmte Objektivation als eine ethische zu qualifizieren und die also als Geltungsgrund für die Ethizität eines jedweden Konkret-Ethischen fungieren.“[8]
Solche moralischen Prinzipien oder Maßstäbe lassen sich im Politischen ebenso wie im Pädagogischen oder Religiösen aufstellen und nach Gründen durchsuchend erläutern.
Wie auch die jeweiligen Einzelwissenschaften, versucht die Philosophie – als das Wissenschaftliche in seiner Gesamtheit Betrachtende – Nachweise einer hinreichenden Begründung und entsprechender Geltung zu finden, um begründetes Wissen als „Erkenntnis von Weltstücken“[9] zu erstellen.
„Diese sich selbst thematisierende und damit sich selbst bewußtmachende Erkenntnis ist nun philosophische Erkenntnis, […] (die) also vom logischen Grund und Ursprung der Erkenntnis (handelt).“[10]
Doch was der logische Grund der Erkenntnis selbst sein soll, ist zu abstrakt, als das es in der Alltagswelt konkrete Anwendung finden würde und so eher im realitätsfernen Elfenbeinturm der theoretischen Philosophie vermutet wird. Wenn also Prinzipien oder Maßstäbe für die Angabe von Gründen aufgestellt werden sollen, dann müssen diese bereits auf vorhandenes Wissen oder zumindest auf eine bekannte inhaltliche Bedeutung rekurrieren.
„Prinzipien sind Bestimmungen des Konkreten in seiner Konkretheit. Sie sind daher das, was sie sind, nur in Bezug auf das, worauf sie bezogen sind und was sie begründen.“[11]
Somit sind etwaige Prinzipen und Maßstäbe insbesondere für die Angabe von moralischen Gründen bereits selbst durch das Moralische bestimmt oder zumindest in ihrer erfahrungswissenschaftlichen Bedeutung beeinflusst.
Was es dann inhaltlich bedeutet über moralische Themenfelder zu philosophieren, kann letztlich ausschließlich durch Erfahrungen der Einzelwissenschaften (wie z.B. der Mathematik oder der Biologie) aufgezeigt werden. Denn erst die Erfahrungen aus den Naturwissenschaften bieten die Grundlagen (Gründe), also auch die Themengegenstände und somit auch die Notwendigkeit, für die Moralphilosophie. Welche möglichen Schlussfolgerungen aus diesen Erfahrungen bezüglich ihrer moralischen Relevanz gezogen werden, liegt dann zunächst in der Tätigkeit des Philosophierens.
„Die Grundlagen der Erfahrung sind die Gründe der Möglichkeit der Erfahrung. In ihnen wird also die wirkliche Erfahrung logisch möglich oder begründet.“[12]
Der Mensch ist, und davon muss ich aus Gründen der Abwesenheit adäquater Alternativen ausgehen, eine biologische Kreatur, die auf die Existenz in der Welt als erkenntnisfähiges Wesen vertraut. Erst die Akzeptanz dieser Prämisse bietet den Grund bzw. die Basis, weitere – z.B. moralische – Erfahrungen machen zu können, um diese dann entsprechend einer kritischen Prüfung bezüglich weiterer Gründe zu konstatieren.
„Erfahrung ist Ausgangspunkt und Ziel zugleich.“[13]
Erst der einzelne Mensch, als erkennendes Subjekt verstanden, bildet die Brücke zwischen dem Abstraktum des gedachten, methodischen aber inhaltsleeren Prinzips und einem Anwendungsbereich dieses Prinzips. So könnte sich das Prinzip des Versprechen Haltens durch das Denken eines Subjektes z.B. auf den naturwissenschaftlichen bzw. empirischen Anwendungsbereich der biologischen Faktoren der Sozialisation in Gruppen beziehen.
„Das konkrete Subjekt ist die notwendige Bedingung konkret-gegenständlicher Sinnkonstitution […].“[14]
Doch wenn das Verständnis des Menschen als erkennendes Wesen in der Welt auf naturwissenschaftlichen Gründen basiert, kommt einem schnell die Endlichkeit eines jeden Lebewesens in den Sinn. Wenn der Mensch ein endliches Wesen ist, und nur der Mensch Prinzipen denken und mit Inhalt (Geltung) füllen kann, muss letztlich auch die Erkenntnis des einzelnen Menschen von dieser Endlichkeit geprägt sein. Erst die Fähigkeit miteinander zu kommunizieren und voneinander zu lernen, hebt zwar nicht die Endlichkeit des Einzelnen auf, aber erweitert das Erkenntnisspektrum über den Einzelnen hinweg – zu Erkenntnissen bzw. gesammelten Erfahrungen einer Gemeinschaft. Dies gilt sowohl für naturwissenschaftliche Themenbereiche, wie auch für daraus resultierende moralphilosophische Fragestellungen.
1.2 Der erkenntnistheoretische Anthropozentrismus als Ausgangsbasis von moralischen Begründungsversuchen
„Was für eine[15] Philosophie man wähle,
hängt davon ab,
was für ein Mensch man ist.“[16]
Anders als die Einzelwissenschaften zeichnet sich die Philosophie durch ständige begriffliche Grundlagenarbeit aus[17]. Um dieser Grundlagenarbeit einen konkreten erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt zu geben, und die Prämisse des Menschen als biologisches Wesen zu unterstreichen, möchte ich die anthropozentrische Perspektive favorisieren.
Wir Menschen können uns nicht aus der Perspektive eines Menschen befreien. Was ich sehe, fühle oder denke, sieht, fühlt oder denkt niemand anderes. Außerhalb meiner Entität kann ich zwar Vermutungen anstellen, dass z.B. ein anderer Mensch Schmerzen hat, da eine tiefe Schnittwunde an dessen Hand aufklafft. Diese Vermutungen kann ich zudem auch mit naturwissenschaftlichen Mitteln unterstützen, indem z.B. die Konzentration von bestimmten Neurotransmittern im Blut gemessen wird. Was ich aber nicht kann, ist, genau das zu empfinden, was das verletzte Gegenüber empfindet. Empfindungen sind höchst subjektive Wahrnehmungen, die nicht mit anderen geteilt werden können.
Das in dieser Arbeit verwendete Moralverständnis lässt sich, mit Kants Vokabular formuliert, als hypothetischen Imperativ verstehen. Da nur das Inhalt und Grundlage von Moral sein kann, was durch die Natur- bzw. Erfahrungswissenschaften nachgewiesen und durch die formale Logik analysiert werden kann, ist ein Moralverständnis, das als unparteiisch, nicht interessengebunden[18] und somit als kategorischer Imperativ zu bezeichnen ist, abzulehnen. Wir Menschen sind damit immer auf unsere menschliche, gar subjektive, Sichtweise und (Fähigkeit zur) Sprache über die zu erkennenden Dinge in der Welt angewiesen, um z.B. moralische Urteile oder Gründe für Handlungen angeben zu können.
[...]
[1] Aus dem Lateinischen: „Glücklich, wer zu erkennen vermochte die Gründe der Dinge.“ Vergil, Georgica 2, 490 in: Puntsch, Eberhard: Zitatenhandbuch, München 2003, S. 154.
[2] Vgl.: Martens, Ekkehard: Methodik des Ethik- und Philosophieunterrichts, 2. Auflage, Hannover 2005, S. 15.
[3] Vgl.: Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt am Main 2003, S. 38 [4.112].
[4] Vgl.: Krijnen, Christian: Begründung als Aufgabe, in: Düwell, Marcus(Hg.): Moralbegründung und angewandte Ethik, Tübingen 1998, S. 23.
[5] Vgl.: Nickel, Gregor: Rationales Argumentieren: Wissenschaftlicher Beweis und ethische Begründung, Tübingen 2003, in: www.fa.uni-tuebingen.de, abgerufen am 01.08.2007.
[6] Krijnen, Christian: Begründung als Aufgabe, in: Düwell, Marcus(Hg.): Moralbegründung und angewandte Ethik, Tübingen 1998, S. 23.
[7] Girnat, Boris: Unterwegs zu einer naturalistischen Ethik – Motivation und Grundideen, Braunschweig 2003, S. 1.
[8] Krijnen: Begründung als Aufgabe […], S. 21.
[9] Krijnen, Christian: Begründung als Aufgabe, in: Düwell, Marcus(Hg.): Moralbegründung und angewandte Ethik, Tübingen 1998, S. 22.
[10] Krijnen: Begründung als Aufgabe […], S. 22.
[11] Krijnen: Begründung als Aufgabe […], S. 24.
[12] Krijnen, Christian: Begründung als Aufgabe, in: Düwell, Marcus(Hg.): Moralbegründung und angewandte Ethik, Tübingen 1998, S. 24.
[13] Krijnen: Begründung als Aufgabe […] S. 24.
[14] Krijnen: Begründung als Aufgabe […] S. 26.
[15] Vgl.: Krebs, Angelika: ökologische Ethik I: Grundlagen und Grundbegriffe, in: Nida-Rümelin, Julian (Hg.): Angewandte Ethik, 2. Auflage, Stuttgart 2005, S. 406-419.
[16] Fichte in: Puntsch, Eberhard: Zitatenhandbuch, München 2003, S. 1003.
[17] So werden verschiedene Termini, wie z.B. ‚Moral’, in den verschiedenen Theorien ‚neu’ bzw. andersartig definiert. Vgl.: Krijnen: Begründung als Aufgabe […], S. 28.
[18] Vgl.: Frankena, William K.: Analytische Ethik – Eine Einführung, 5. Auflage, München 1994, S. 39f..