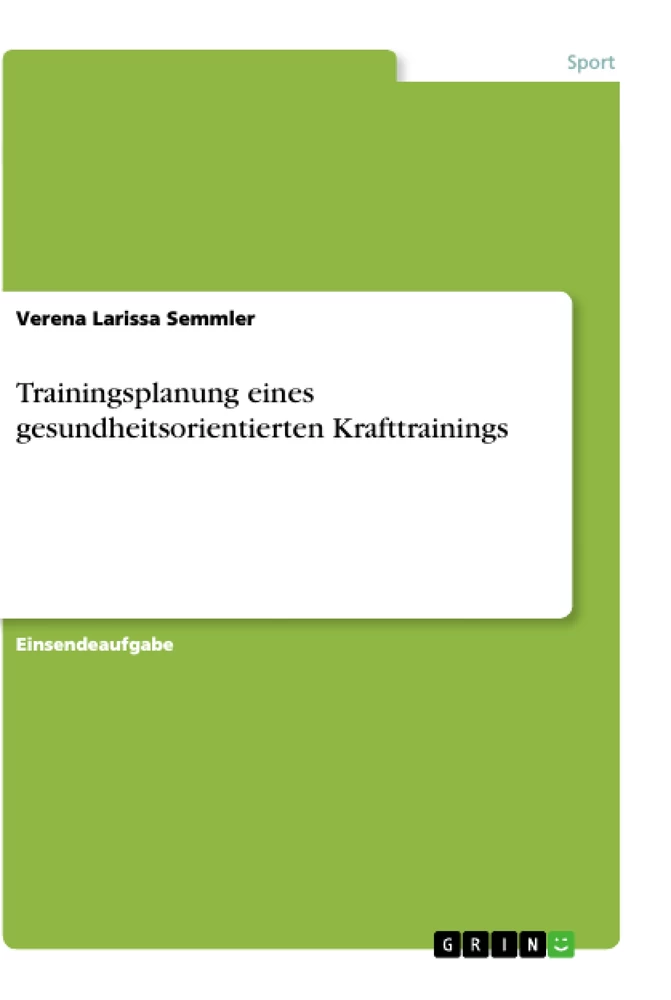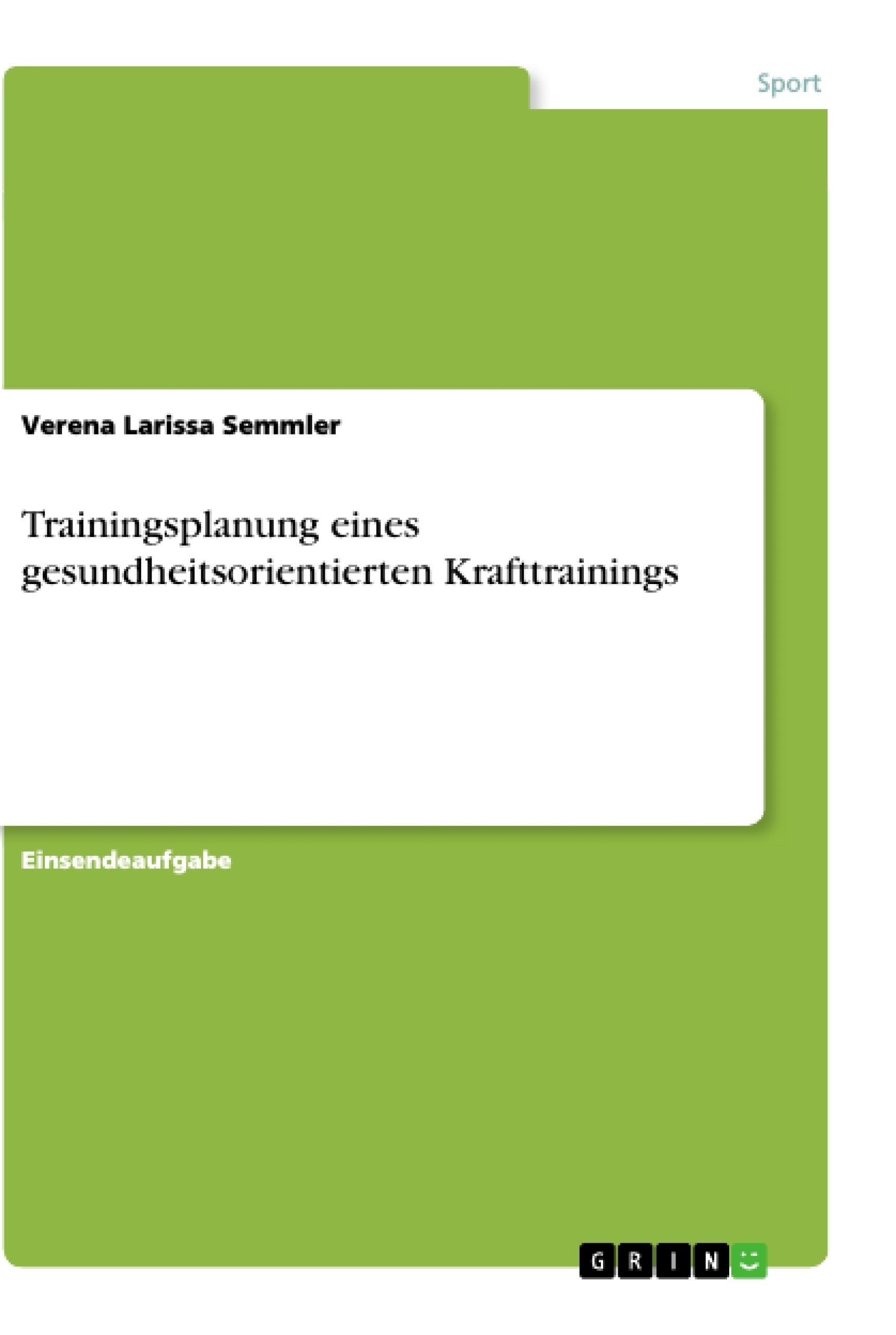Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Planung eines Trainingsplans für ein Krafttraining. Zunächst wird die Diagnose aufgestellt. Hierbei wird auf die allgemeinen und die biometrischen Daten der Probandin eingegangen, sowie ein Krafttest durchgeführt. Anschließend folgen die Prognose und Zielsetzung.
In Kapitel 3 wird ein Trainingsplan Makrozyklus vorgestellt. Hierfür wird zunächst die übergeordnete Trainingsmethode dargestellt. Anschließend wir ein Trainingsplan entwickelt. Des Weiteren wird auf die Belastungsparameter, Organisationsformen und Periodisierung eingegangen. In Kapitel 4 wird dann ein Trainingsplan Mesozyklus erstellt. Hierbei wird zunächst das übergeordnete Konzept der Übungsauswahl erläutert und schließlich ausgewählte Übungen konkret betrachtet. Kapitel 5 behandelt die Thematik Krafttraining bei Diabetes Mellitus Typ 2.
Bei der Probandin handelt es sich um eine 25-jährige Frau, deren Trainingsmotive das Abnehmen und die Definierung des Körpers sind. Zu Beginn werden anthropometrische Daten erhoben und eine Anamnese durchgeführt. Die genaue Körperzusammensetzung wird mittels der Bioelektrischen Impedanzanalyse durch den Bodyscan der Firma CardioScan gemessen und der Blutdruck nach der auskultatorischen Messung nach Riva-Rocci ermittelt. Aktuell nimmt die Probandin einmal pro Woche an einem einstündigen Ausdauerkurs teil und fährt circa zweimal pro Woche für insgesamt ungefähr zwei Stunden Fahrrad.
Inhaltsverzeichnis
1 DIAGNOSE
1.1 Allgemeine und biometrische Daten
1.2 Krafttestung
2 ZIELSETZUNG/PROGNOSE
3 TRAININGSPLANUNG MAKROZYKLUS
3.1 Übergeordnete Trainingsmethode
3.2 Trainingsplan
3.3 Belastungsparameter
3.4 Organisationsformen
3.5 Periodisierung
4 TRAININGSPLANUNG MESOZYKLUS
4.1 Übergeordnetes Konzept der Übungsauswahl
4.2 Einzelbetrachtung der gewählten Übungen
5 KRAFTTRAINING BEI DIABETES MELLITUS TYP-2
6 LITERATURVERZEICHNIS
7 TABELLENVERZEICHNIS
1 Diagnose
1.1 Allgemeine und biometrische Daten
Für eine weibliche Trainingsanfängerin wird ein Trainingsplan erstellt und zu Beginn anthropometrische Daten erhoben sowie eine ausführliche Anamnese durchgeführt. Die Körperzusammensetzung wird mittels der Bioelektrischen Impedanzanalyse (Edlinger, 2002) durch den Bodyscan der Firma CardioScan gemessen, der Tagespuls ertastet und der Blutdruck nach der auskultatorischen Messung nach Riva-Rocci ermittelt.
Tab. 1: Diagnosedaten und Zusammenfassung Anamnese (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die optimalen Werte der Körperzusammensetzung für die Probandin wurden dem Programm Cardioscan (Weitl, 2019) entnommen. Der Blutdruck wurde am Tag nach ca. 30 Minuten sitzen gemessen und beträgt 126/83 mmHg. Es liegt somit nach den in Tab. 2 dargestellten Klassifikationen ein Normblutdruck vor und es muss im Krafttraining nicht spezifisch darauf eingegangen werden. Die Kundin hat unregelmäßig Schmerzen im un- teren Rücken und keine weiteren gesundheitlichen Einschränkungen. Laut Ihrem Orthopäden sind die Rückenschmerzen muskulär bedingt, da die Schmerzen unregelmäßig an der Arbeit und vor allem beim Heben von Patienten entstehen. Er sprach die Empfehlung über ein Muskelaufbautraining aus. Die Person hat folglich keine Einschränkungen für die Trainierbarkeit, lediglich muss der Trainingsplan Übungen für den Rumpf enthalten um diesen nachhaltig zu stärken und der Person die Rückenschmerzen an der Arbeit zu nehmen.
Tab. 2: Blutdruckklassifikationen (modifiziert nach Mancia et al, 2013, S. 1286)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.2 Krafttestung
Es wird der X-RM-Test gewählt und durchgeführt um die Individuelle-Leistungsbild- Methode oder auch ILB-Methode verwenden zu können (Barteck & Elsner, 1998; Eif- ler,2000; Strack, 1999; Strack & Eifler, 2005). Bei diesem Test wird das maximal bewältigbare Gewicht für eine bestimmte Wiederholungszahl ermittelt und ist gut geeignet für Krafttrainingsanfänger. Ein Krafttest mit dem 1-RM-Test ist ausgeschlossen, da es sich um einen Beginner handelt. „Insbesondere im fitnessorientierten Krafttraining für Anfänger ist es angebracht, (...) aus Gründen der internistischen und orthopädischen Belastung auf 1-RM-Tests (...) zu verzichten“ (Haupert, 2007, S. 68).
Der Test wird mit 20 Wiederholungen zu Beginn durchgeführt, da er vor Trainingsbeginn durchgeführt wird und als Grundlage für die Intensität im ersten Mesozyklus dient.
Der Ablauf (Zimmer, 1999, S. 45-47) beginnt methodisch mit einem allgemeinen (15 Minuten Crosstrainer) und speziellen Aufwärmen (mit geringer Intensität für jede Übung). Im Anschluss wird der 1. Testsatz mit 20 Wiederholungen durchgeführt. Das Startgewicht ist dabei subjektiv vom Trainer einzuschätzen, aber es gibt Anhaltspunkte wie zum Beispiel für die Beinpresse 100% des Körpergewichtes bei Frauen als Testgewicht im ersten Satz zu wählen (Eifler, 2000, S.69). Anschließend wird ein zweiter und bei Bedarf ein dritter Testsatz mit jeweils drei Minuten Pause durchgeführt und dabei wird das Gewicht um 5 %, 10 % oder 25 % gesteigert je nach subjektivem Empfinden der Testperson (Zimmer, 1999, S. 45-47). Das Zielgewicht des Testes ist erreicht, wenn die letzte konzentrische Wiederholung gerade noch vollzogen werden kann. Für optimale Testbedingungen sollte die normale Trainingsuhrzeit auch für den Test gewählt werden und der Testtag dem normalen Alltag entsprechen.
Tab. 3: Testsätze und Ergebnisse des 20-RM-Test (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Testergebnisse fließen in die weitere Trainingsplanung ein, weil mit bestimmten Intensitäten des im X-RM-Test erreichten Kraftwert trainiert wird (vgl. Kapitel 3). Der Krafttest wird nach jedem Mesozyklus erneut durchgeführt mit der Anzahl an Wiederholungen des folgenden Zyklus. Um einen intraindividuellen Leistungsvergleich darzustellen wird nach Beendigung des Trainingsplan ein erneuter 20-RM-Test durchgeführt welcher unter konsequenter und exakter Standardisierung stattfinden muss. Die Rahmenbedingungen, wie Ablauf, Methodik und Uhrzeit müssen dann so ablaufen wie in Tab. 3 dargestellten Test.
Ein interindividueller Leistungsvergleich ist aufgrund der Störgrößen und fehlender Standardisierung eines X-RM-Test nicht möglich.
2 Zielsetzung/Prognose
Die Probandin hat ihre Trainingsmotive mit abnehmen und definieren geschildert und bei der Anamnese leichte Rückenschmerzen angegeben. Nach der Diagnose werden drei Ziele mit ihr erarbeitet, welche konkret verfasst, eindeutig und messbar sein müssen.
Tab. 4: Zielsetzung (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abnehmen lässt sich als Ziel nicht konkretisieren und eindeutig messen, deswegen ist hier das Ziel den Körperfettanteil zu reduzieren. Für den Wunsch der Definition ist der Aufbau der Muskelmasse der Anhaltspunkt, da eine optische Körperformung über Körperfettreduktion und Muskelaufbau erfolgt. Die Muskeln sind von außen mehr zu erkennen, wenn weniger Körperfett diesen umgibt und der Muskel hypertrophiert ist. In Tab. 4 sind die Grobziele dargestellt und um die Motivation der Trainierenden dauerhaft zu erhalten werden Feinziele in Tab.5 definiert. Die Parameter dafür werden gemessen und dokumentiert.
Tab. 5: Feinziele (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das dritte Ziel ist die Linderung der Rückenschmerzen. Die Probandin hat dies nicht als Motiv angegeben aber in der Anamnese als Störfaktor bezeichnet. In diesem Fall kann die Kraftsteigerung Rumpfextension als Ziel gewählt werden, da die Schmerzen muskulär bedingt sind. Hierfür ist die Wiederholung des 20-RM-Test der Rückenextension nach Beendigung des Trainingsplan (vgl. Kapitel 1.2) erforderlich.
Das Ausmaß ist bei allen drei Zielen realistisch gewählt damit keine Demotivation bei den Vergleichsmessungen entsteht.
[...]