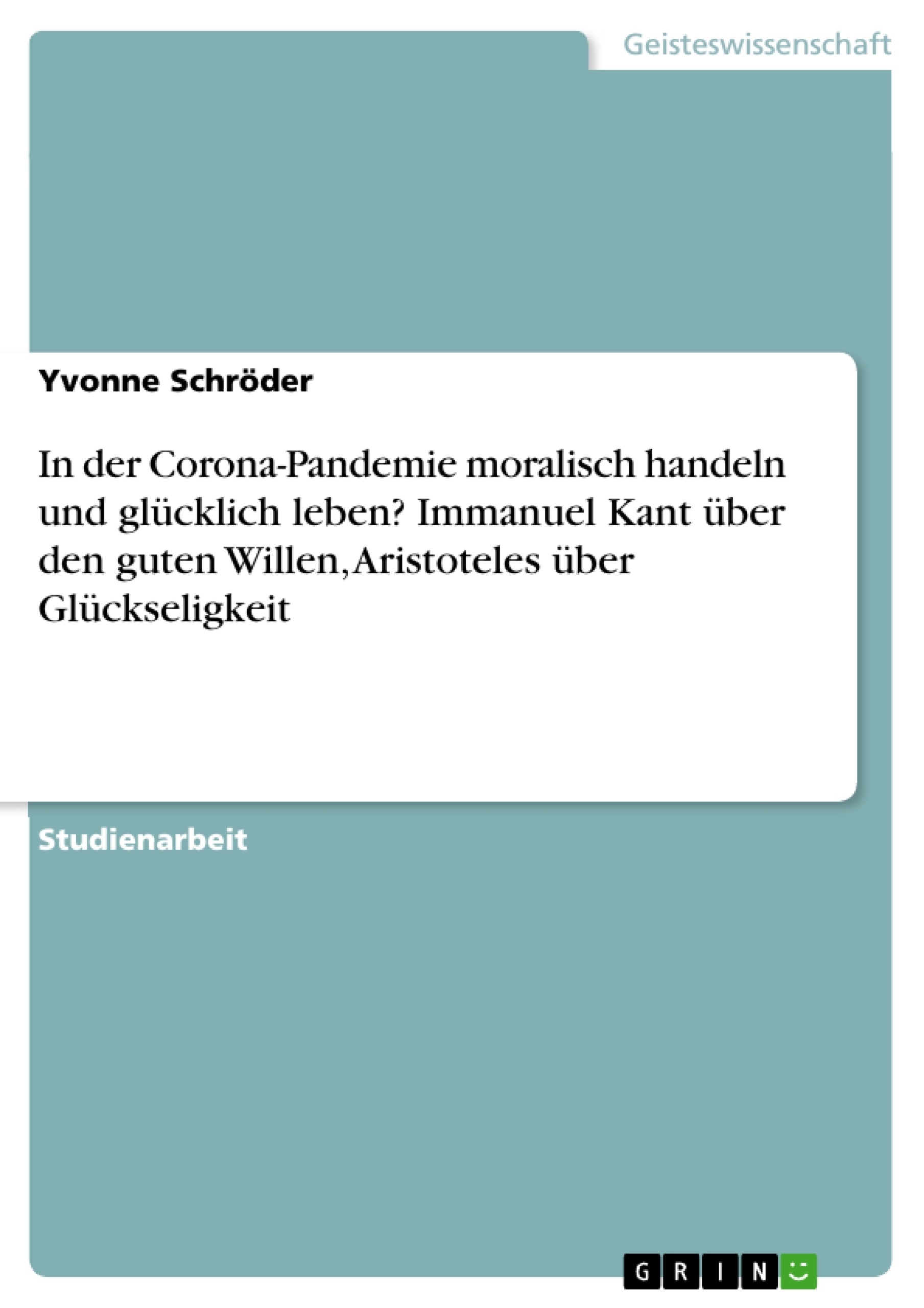Januar 2020. Ein Virus namens Covid-19 breitet sich rasant auf der gesamten Erdkugel aus und verändert das Leben jedes einzelnen Menschen. Wie ist also ein glückliches und erfülltes Leben überhaupt und vor allem in solch einer Situation möglich, und wie handelt man moralisch? Dieses Virus ist in ca. 5% der Fälle tödlich, seine Ausbreitungsgeschwindigkeit exponentiell. Folglich werden durch die einzelnen Regierungen weltweit hektisch Maßnahmen ergriffen. Temporäre Ausgangsbeschränkungen, Verbote von sozialen Kontakten und das Tragen eines Mundschutzes gehören von nun an zum Alltag. Diese Vorkehrungen werden einerseits getroffen, damit sich die stark ansteigende Infektionszahl verlangsamt und dadurch andererseits möglichst wenig Toden aus der aktuellen Pandemie resultieren. Solche Einschränkungen führen zu einer geringeren Lebensqualität vieler Bürger. Einige protestieren gegen diese Maßnahmen und fordern mehr Freiheiten in ihrem alltäglichen Leben.
Die Suche nach einem glücklichen Leben ist wohl so alt wie die Philosophie selbst. „Jede Kunst und jede Lehre, desgleichen jede Handlung und jeder Entschluß, scheint ein Gut zu erstreben, weshalb man das Gute treffend als dasjenige bezeichnet hat, wonach alles strebt.“ – Aristoteles Nikomachische Ethik. Schon vor Jahrtausenden, etwa zur Zeit der alten Griechen befasste sich Aristoteles mit der Suche nach dem höchsten Gut und der Glückseligkeit. Er erarbeitete auf diese Frage eine umfassende Antwort in seinem Werk „Nikomachische Ethik“, welches bis heute Grundlage für viele Theorien ist. Auch Immanuel Kant verfasste im Jahr 1785 sein Werk „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“, in der er das höchste Gut mit seiner Theorie des „guten Willens“ beschreibt. Der schmale Grad zwischen einer moralisch guten Tat und dem Ausleben der eigenen Gelüste soll im Folgenden mit Hilfe von dieser beiden Anschauungen diskutiert werden. Zum einen wird das Werk von einer sehr alten Sichtweise des Aristoteles durchleuchtet und anschließend mit einer neueren Betrachtung, die des Immanuel Kants, verglichen.
In der Corona-Pandemie moralisch handeln und glücklich leben? Immanuel Kant über den guten Willen, Aristoteles über Glückseligkeit
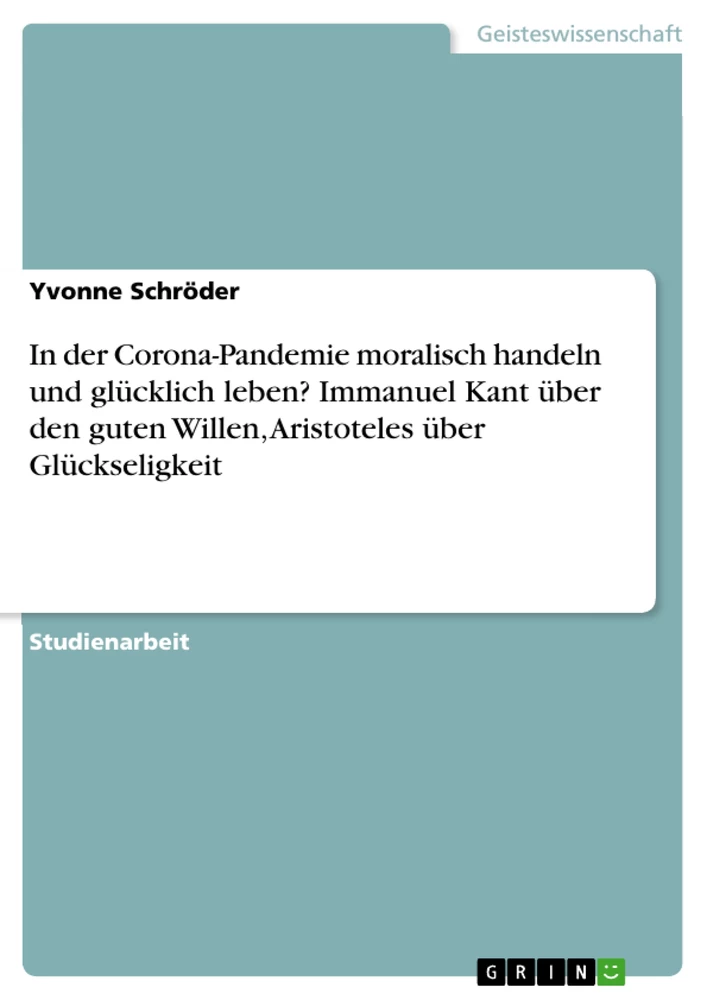
Hausarbeit , 2020 , 11 Seiten , Note: 1,0
Autor:in: Yvonne Schröder (Autor:in)
Philosophie - Epochenübergreifende Abhandlungen
Leseprobe & Details Blick ins Buch