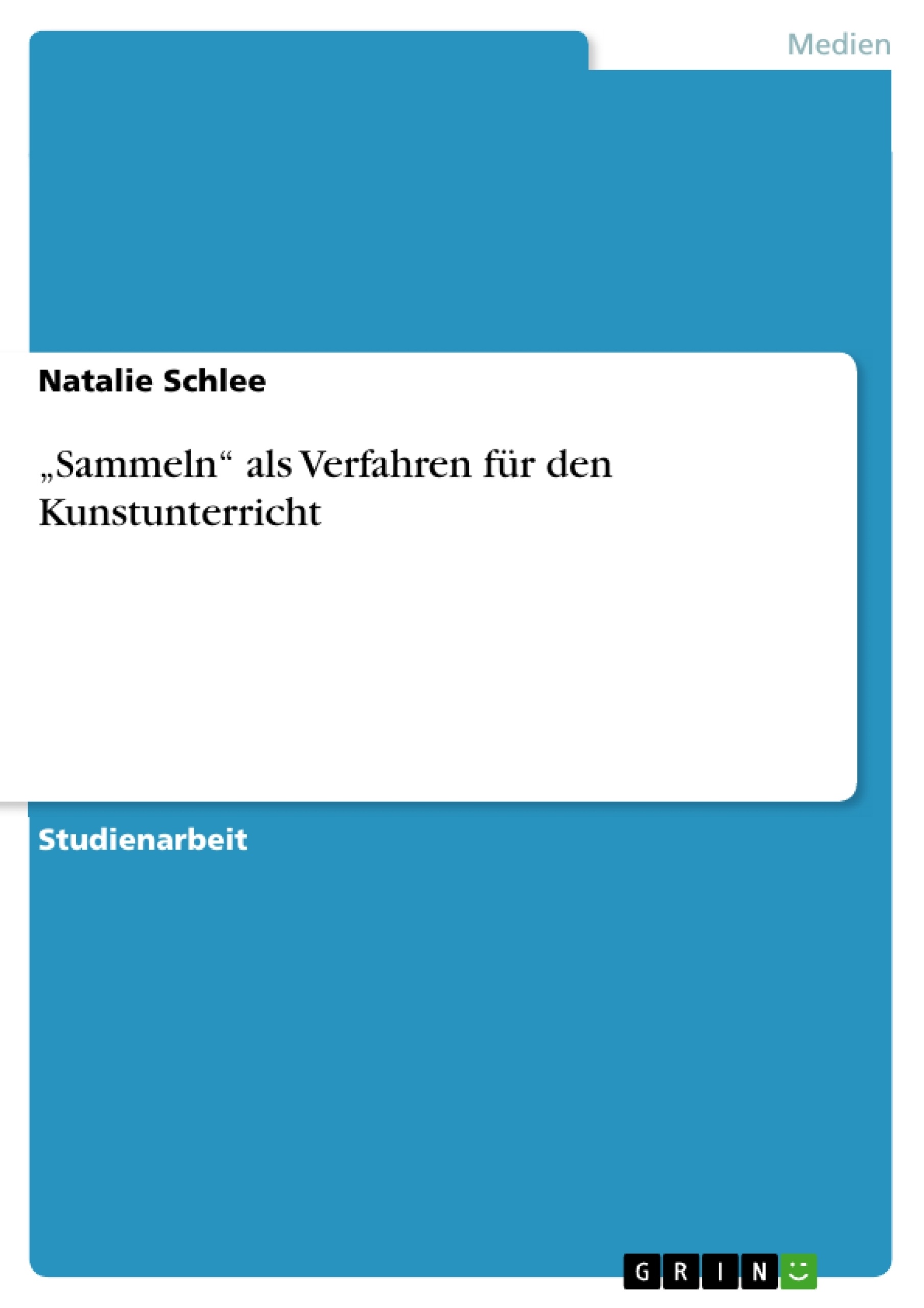Das Sammeln ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Gesammelt wurde in Schatzhäusern
und Totenkammern, in Tempeln und Kirchen – gesammelt wurde in fürstlichen Galerien, aus
denen im 18. Jahrhundert staatliche Museen wurden. Sammeln ist heute neben Forschen und
Öffentlichmachen einer der grundlegenden Aufträge der Museen.
Sammeln ist eine Form der Selbst- und Welterfahrung und es trägt zur Bestimmung und
Erweiterung der Identität bei.
Die Bedeutung eines Sammelobjektes liegt in seiner Beziehung zum Sammler. Der Sammler
projiziert Erinnerungen, Wünsche, Sehnsüchte und Träume auf den Sammelgegenstand. Die
Motive für das Sammeln sind vielfältig. Gesammelt wird aus Genuss, Neugier,
Entdeckerfreude, aber auch aus Besitzgier und Vollständigkeitswahn.
Zwei Arten des Sammelns können unterschieden werden. Die „geschlossene“ Form entspricht
dem, was meist mit dem Begriff einer Sammlung verbunden wird: es existiert ein bestimmter
begrenzter Rahmen, der durch die gesammelten Dinge ausgefüllt wird. Das Ideal einer
solchen Sammlung ist ihre Komplettheit. Sie stellt ihren Besitzer erst dann zufrieden, wenn
sie komplett ist. Ein Beispiel dafür ist die Briefmarkensammlung.
Für den Kunstunterricht ist jedoch die „offene“ Form des Sammelns interessanter. Denn ihr
liegt eine Idee, ein thematischer roter Faden zugrunde, entlang dem Dinge gesammelt werden;
solch eine Sammlung ist wandelbar und hat keine definierte, auszufüllende Figur. Das
Sammeln geschieht dabei beiläufig, mit gestreuter Wahrnehmung, eher spielerisch und vom
persönlichen Gefallen geleitet, oft sogar dem Zufall gehorchend. Beispiele für solches
Sammeln finden sich in der Art und Weise, wie Kinder sammeln oder wie (Erinnerungs-)
Fotos aufbewahrt werden.
„Sammeln“ als Verfahren für den Kunstunterricht
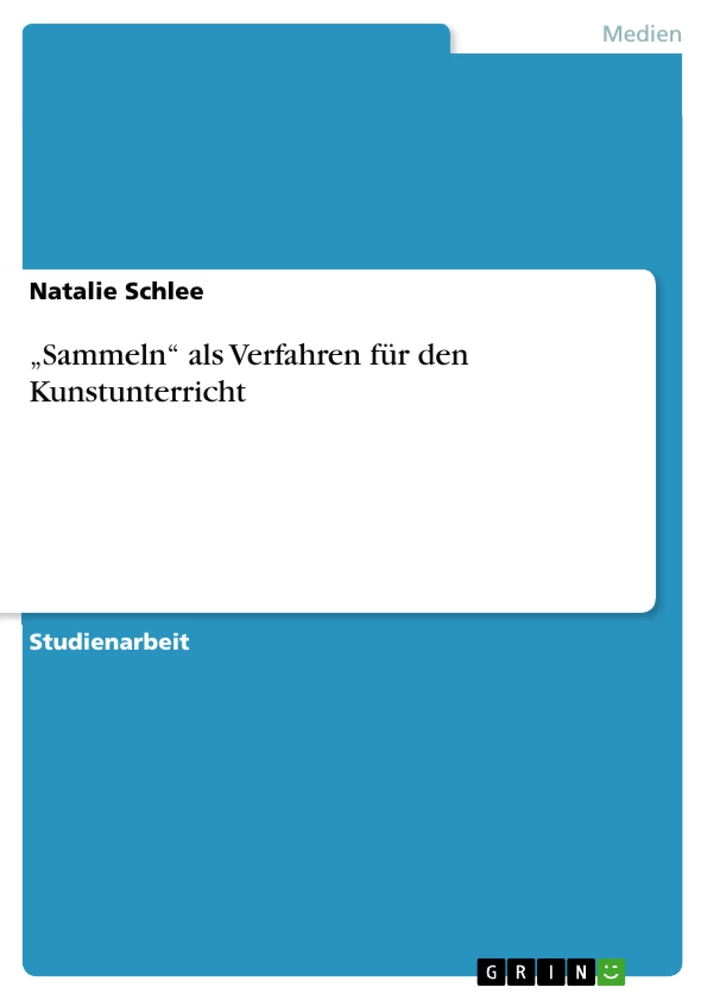
Referat (Ausarbeitung) , 2008 , 8 Seiten , Note: 2,0
Autor:in: Natalie Schlee (Autor:in)
Leseprobe & Details Blick ins Buch