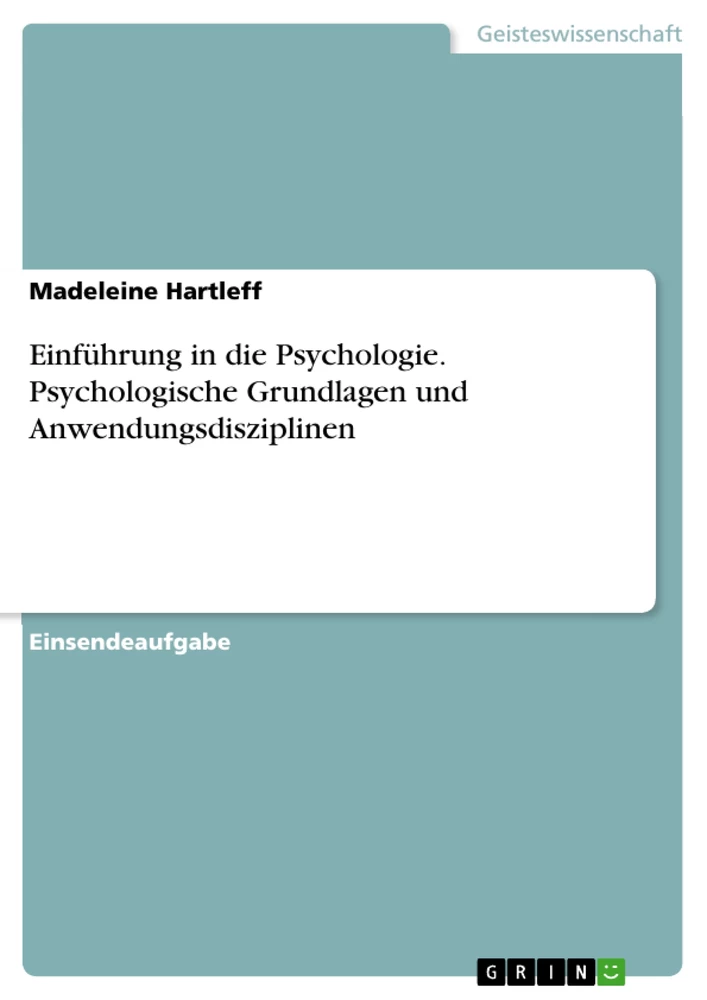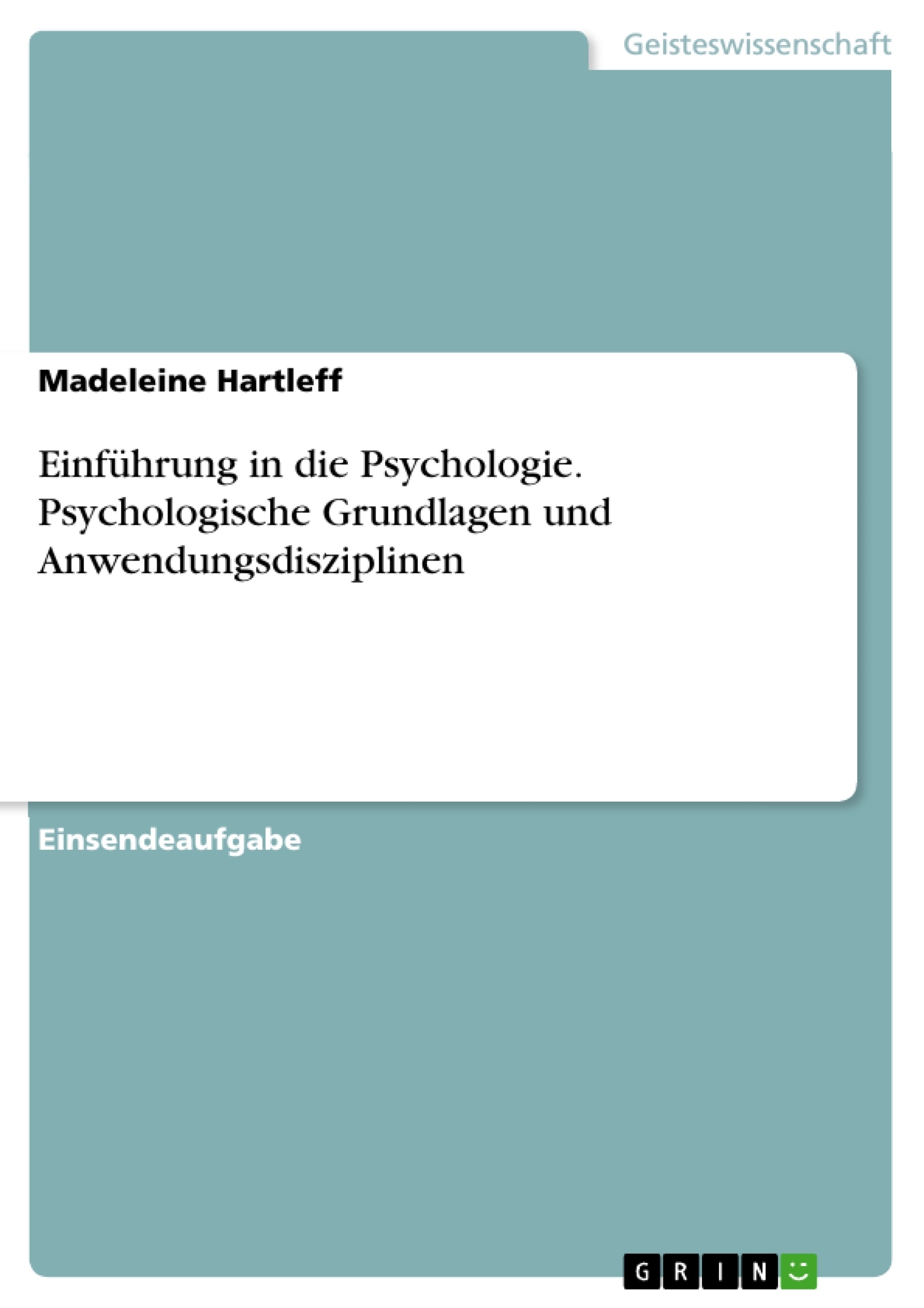Diese Arbeit bietet eine Einführung in einige Grundlagen der Psychologie. Im ersten Teil wird das Verhältnis von psychologischen Grundlagen- und Anwendungsfächern vorgestellt. Des Weiteren wird ein Überblick über die Inhalte der Grundlagendisziplinen gegeben. Anschließend wird der Theorie-Praxis-Transfer in der Psychologie beispielhaft an der Sportpsychologie dargestellt.
Im zweiten Teil werden Formen der Lernmotivation vorgestellt. Im Anschluss daran werden die Auswirkungen der Motivation im Lernprozess erläutert. Der dritte Teil beginnt mit einer Darlegung der psychologischen Anwendungsfächer. Danach werden neue Trends in der Psychologie behandelt. Abschließend wird auf die Lösung aktueller gesellschaftlicher, sozialer und wirtschaftlicher Probleme mithilfe von psychologischer Anwendungsforschung eingegangen.
Die Lehre der Psychologie setzt sich mit dem Verhalten und Erleben einzelner Individuen und deren kognitiven und mentalen Abläufen im Gehirn und den damit zusammenhängenden physiologischen Vorgängen auseinander. In der Wissenschaft, so auch in der Psychologie, wird sich kaum eine Psychologin oder ein Psychologe als Spezialist für die komplette Psychologie bezeichnen. Jede Psychologin und jeder Psychologe hat sich auf bestimmte Bereiche fokussiert, dies können bestimmte Themen sein, oder auch eine Fokussierung auf ein Gebiet der Grundlagen- oder Anwendungsfelder.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Aufgabenstellung
1 Aufgabe B1
1.1 Verhältnis von psychologischen Grundlagen- und Anwendungsfächern
1.2 Überblick über die Inhalte der Grundlagendisziplinen
1.3 Theorie-Praxis-Transferin derPsychologie amBeispiel der Sportpsychologie
1.4 Fazit
2 AufgabeB2
2.1 Begriffserklärungen und Formen der Lernmotivation
2.2 Auswirkungen der Motivation im Lernprozess
2.3 Fazit
3 Aufgabe B3
3.1 Psychologische Anwendungsfächer
3.2 Neue Trends in der Psychologie
3.3 Lösung aktueller gesellschaftlicher, sozialer und wirtschaftlicher Probleme mit Hilfe von psychologischer Anwendungsforschung
3.4 Fazit
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Grundlagen und Anwendungsfächer der Psychologie
Abbildung 2: Anwendungsfelder der Sportpsychologie
Abbildung 3: Das Rubikon-Modell des Handelns
Abbildung 4: Modell der pädagogischen Situation
Abbildung 5: Individual- und Massenkommunikation
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: diverse Motivationsarten mit ihren Zielen für das Lernen
Aufgabenstellung
Die Aufgabenstellung wurde aus urheberrechtlichen Gründen durch das Lektorat entfernt.
1 Aufgabe Bl
Im ersten Teil dieser Aufgabe soll das Verhältnis der Grundlagenfächer zu den Anwen- dungsfächem erläutert werden. Dabei wird auch auf die Bedeutung von Theorien und Modellen in der Angewandten Forschung eingegangen. Im Anschluss werden die einzelnen Grundlagendisziplinen kurz vorgestellt. Anhand der Sportpsychologie wird der Transfer von der Theorie zur Praxis verdeutlicht.
1.1 Verhältnis von psychologischen Grundlagen- und Anwendungsfächern
Die Lehre der Psychologie setzt sich mit dem Verhalten und Erleben einzelner Individuen und deren kognitiven und mentalen Abläufen im Gehirn und den damit zusammenhängenden physiologischen Vorgängen auseinander (Gerrig, 2016, S. 2; Myers, 2014, S. 6; Prinz, Müsseler & Rieger, 2017, S. 2). In der Wissenschaft, so auch in der Psychologie, wird sich kaum eine Psychologin oder ein Psychologe als Spezialist für die komplette Psychologie bezeichnen. Jede Psychologin undjeder Psychologe hat sich auf bestimmte Bereiche fokussiert, dies können bestimmte Themen sein, oder auch eine Fokussierung auf ein Gebiet der Grundlagen- oder Anwendungsfelder. (Nolting & Paulus, 2016, S. 21) Forschende der Psychologie, die Grundlagenforschung vorantreiben, haben als Ziel die Verhaltensweisen von Menschen und Tieren in verschiedenen Situationen des Lebens zu beobachten, zu beschreiben und vorherzusagen (Gerrig, 2016, S. 4). Diese Theorien und Modelle sollen nach Möglichkeit losgelöst von Zeit und Ort bestehen. Der Grundlagenforschende erhält seine Fragestellungen in erster Linie aus dem Sachzusammenhang seines wissenschaftlichen Zweigs und aus dem Fortführen und Bilden von Theorien. Daraus lässt sich ableiten, dass die Fragestellungen, die die Grundlagenforschung aufgreift, psychologieinterne Problemstellungen sind. (Frey, Graf Hoyos & Stahlberg, 1988, S. 23) Im Gegenzug dazu zielen die Anwendungsfelder auf eine Verbesserung der Lebenssituation von Menschen und der Gemeinschaften ab (Gerrig, 2016, S. 4). Probleme der Realität werden von extern an die Psychologie herangetragen. Bei diesen Themen steht das menschliche Verhalten in bestimmten Situationen im Mittelpunkt (Frey et al., 1988, S. 21, 1988, S. 23-25). Dazu benutzt die Angewandte Psychologie allgemeine Modelle und Theorien aus den Grundlagenfächern und adaptiert diese auf ihre speziellen Fragestellungen. Im Gegensatz zur Grundlagenforschung ist es in der Angewandten Psychologie nicht notwendig, neuartige Theorien zu entwickeln, die für die Allgemeinheit gültig sind und vorhandenes Wissen zu mehren. Es reicht aus, wenn vorhandene Modelle und Theorien so weiterentwickelt werden, dass sie den angestrebten Zielvorstellungen entsprechen. (Frey et al., 1988, S. 23-25) Personalpsychologinnen und -psychologen zum Beispiel beschäftigen sich mit der Gewinnung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit der Beurteilung von Angestellten und mit dem Ausbau von Kompetenzen einzelner Mitarbeitenden und Führungskräften (Mendius & Weither, 2019, S. 90). Mithilfe der Abbildung 1 wird ein Überblick über die Grundlagenfächer und einige Anwendungsfächer gegeben. Anschließend werden die Grundlagenfächer mit ihren Inhalten kurz erläutert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Grundlagen und Anwendungsfächer der Psychologie
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Deutsche Gesellschaft für Psychologie e.V. [DGPs],2018b)
1.2 Überblick über die Inhalte der Grundlagendisziplinen
Die Allgemeine Psychologie betrachtet den Menschen und nicht das Individuum an sich. Sie fragt nach dem, was alle Menschen gemeinsam haben. Dabei beschäftigt sich die Allgemeine Psychologie mit den grundlegenden Prozessen und Mechanismen der Wahrnehmung, des Gedächtnisses und Lernens, des Denkens, der Sprache, der Motivation und der Emotion. (Kiesel & Spada, 2017, S. 19; Prinz et al., 2017, S. 4; Schütz, Wolstein & Lautenbacher, 2011, S. 22) Die in der Allgemeinen Psychologie erworbenen Erkenntnisse sind wesentlich für die anderen Teildisziplinen der Psychologie (Kiesel & Spada, 2017, S. 19-20).
Die Differentielle und Persönlichkeitspsychologie beschäftigt sich mit den Besonderheiten im Verhalten und Erleben von Individuen (Asendorpf, 2017, S. 60). Literaturabhängig werden die Bereiche Differentielle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie im deutschsprachigen Raum getrennt betrachtet (Rammsayer & Weber, 2005, S. 11). Die Persönlichkeitspsychologie befasst sich mit den persönlichen, charakteristischen und individuellen Eigenschaften eines Menschen in seiner körperlichen Gestalt, seinem Auftreten und seinem Erleben (Neyer & Asendorpf, 2017, S. 19; Schütz et al., 2011, S. 22). Während die Differentielle Psychologie verschiedene Menschen bezüglich definierter Merkmale zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet. Psychologinnen und Psychologen möchten aus diesem Grund erforschen, ob es bei verschiedenen Personen ein unterschiedliches Verhalten und Erleben in einer definierten Situation gibt. Es kann aber auch eine Person zu verschiedenen Zeitpunkten beurteilt werden. (Asendorpf, 2017, S. 60; Stemmier, Hagemann, Amelang & Spinath, 2016, S. 20)
Die Entwicklungspsychologie betrachtet ein Individuum in seinem Erleben und Verhalten sowie seiner sozialen, kognitiven und physischen Entwicklung von seiner Zeugung bis zu seinem Tod (Myers, 2014, S. 178; Schwarzer & Walper, 2017, S. 35). Entwicklungspsychologinnen und -psychologen wollen ermitteln, wie und warum sich die mentalen Fertigkeiten und die gesellschaftlichen Verbindungen im Laufe der individuellen Existenz herausbilden und formen (Gerrig, 2016, S. 368). Zu dieser Betrachtung gehören ebenfalls negative Erlebnisse und der Umgang mit diesem Erlebten (Flammer & Gasser, 2007, S. 15-16).
Die Grundlage für die Sozialpsychologie ist das Analysieren von sozialen Situationen, in welchen Personen teilnehmen (Sherif, 1982). Hierbei geht es um die Wirkung von Individuen auf ihre Umwelt, die Wirkung durch Dritte, die auf diese Umwelt Einfluss nehmen und dadurch auf das Individuum wirken und die Wirkung der Umwelt auf das Individuum (Fischer, Jander & Krueger, 2018, S. 1; Prinz et al., 2017, S. 2; Schmithüsen & Steffgen, 2015, S. 96). Sozialpsychologinnen und-psychologen versuchen herauszufinden, warum wir uns, als Individuum, in unterschiedlichen Gegebenheiten verschieden verhalten (Myers, 2014, S. 596).
Die Biologische Psychologie gibt eine biologische Perspektive auf das Verhalten und Erleben eines Menschen und reduziert diese dynamischen und komplexen Beziehungen aller Organe im Körper nicht nur auf physiologische Prozesse (Birbaumer & Schmidt, 1996, S. 3; Dewsbury, 1991, S. 198; Prinz et al., 2017, S. 2). Um das Verhalten von Menschen und Tieren bei bestimmten Gegebenheiten Vorhersagen zu können, ist es wichtig die verschiedenen elementaren psychischen Aufgaben des Nervensystems (wie z. B. Schlafen, Lernen, Konzentration) zu verstehen. Die Allgemeine Psychologie wird hier mit dem Wissen aus der biologischen Psychologie verbunden. (Birbaumer & Schmidt, 1996, S. 3-4; Schmithüsen & Anton, 2015, S. 161)
1.3 Theorie-Praxis-Transfer in der Psychologie am Beispiel der Sportpsychologie
Anhand der Sportpsychologie soll gezeigt werden, wie der Transfer von theoretischen Grundlagen in die Praxis funktionieren kann. Aber was ist Sportpsychologie und womit beschäftigt sich diese? Als Erstes kommt einem wahrscheinlich in den Sinn, dass sich Sportpsychologie mit Leistungssport beschäftigt (Hänsel, Baumgärtner, Kornmann & Ennigkeit, 2016, S. 2). Das ist richtig, aber es gibt noch weitere Anwendungsgebiete, wie in Abbildung 2 dargestellt ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Anwendungsfelder der Sportpsychologie
Je nach Literatur wird Sportpsychologie sehr unterschiedlich definiert. Dieses anwendungsorientierte Fach kann aus Sicht der Psychologie betrachtet werden, oder aus Sicht der Sportwissenschaften (Schlicht, 2009, S. 7-9). Nach Brand (2010, S. 10) wird Sportpsychologie aus Sicht der Psychologie als angewandte Wissenschaft betrachtet, die das Erleben und Verhalten von Sportlern, deren Übungsleitung und dem Publikum versucht zu erläutern, zu deuten, zu formen und zu prognostizieren.
Die DAK-Gesundheitskasse beauftragt jährlich die Forsa deutsche Bürger nach ihren „guten Vorsätzen für das neue Jahr“ zu befragen. Im Dezember 2017 gaben 52,5 % aller Befragten an: Sie wollen sich im kommenden Jahr mehr bewegen und sie wollen mehr Sport treiben. (DAK-Gesundheit & Forsa, 2017, S. 2). Es kann daraus gefolgert werden, dass die Hälfte der Deutschen motiviert ist, Sport zu treiben. Nach Hänsel und Kollegen (2016, S. 98) hielt davon wiederum nur die Hälfte aller Befragten ihren Vorsatz ein. Was hält die Menschen vom Sporttreiben ab? Wo doch die Motivation vorhanden ist? Und wie muss vorgegangen werden, um seine gesetzten Ziele zu erreichen? In der Sportpsychologie werden solche Fragen nach dem Willen (Volition) mit den Grundlagen aus der Allgemeinen Psychologie erörtert. Narziß Ach beschreibt in seinem Buch „Analyse des Willens“ als einer der ersten Psychologen im Jahr 1935 den Willensakt. Nach seiner Definition handelt es sich dabei um einen Prozess im Inneren. Dieser tritt auf, wenn die Person auf dem Weg zur Erreichung ihres oder seines Zieles auf innere oder äußere Widerstände getroffen wird. Dieser Widerstand muss wiederum zuerst ins Bewusstsein gelangen, um überwunden zu werden. (Ach, 1935, S. 196) Mitte der 1980er Jahre wurden gleichzeitig zwei maßgebende Theorien in der Volitionsforschung entwickelt. Bei den Modellen handelt es sich um das Handlungsphasen-Modell, auch Rubikon-Modell genannt, von Heckhausen und Gollwitzer sowie die Handlungskontrolltheorie von Kuhl. (Brandstätter, Schüler, Puca & Lozo, 2013, S. 113)
Kuhl (1983, S. 313-325) beschreibt mit der Theorie der Handlungskontrolle ein Modell von volitionalen Mechanismen zur Unterstützung der Motivation, wenn dem Ausführenden sich Gegenwehr entgegenstellt. Bisher wurde dieses Modell mit zahlreichen Studien hauptsächlich im Leistungssport angewendet (Beckmann, Fröhlich & Elbe, 2009, S. 541). Da diese Arbeit die Volition im Rahmen des Freizeit- und Breitensports betrachtet, wird auf dieses Modell nicht näher eingegangen.
Das Rubikon-Modell und andere Theorien und Modelle im Zusammenhang mit der Motivation wurde von Fuchs (1997, S. 264-289) als Ausgangspunkt für Erklärungen im Gesundheitssport (integratives Motivationsmodell: MAARS) verwendet. Das Modell der Handlungsphasen möchte die folgenden Fragen beantworten (Achtziger & Gollwitzer, 2006, S. 278):
- Wie sucht eine handelnde Person ihre oder seine Absicht beziehungsweise ihr oder sein Zielvorhaben aus?
- Wie plant der Handelnde die Ausführung ihres oder seines Ziels?
- Wie meistert sie oder er dieses Bestreben?
- Wie beurteilte die Person ihre Anstrengungen bis zur Erreichung des Ziels?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Das Rubikon-Modell des Handelns
Wie in der Abbildung 3 zu sehen, werden die Vorgänge im Rubikon-Modell als Sequenzen von vier aufeinanderfolgenden Phasen (Abwägen, Planen, Handeln und Bewerten) beschrieben. Jeder der Handlungsphasen stellt andere Ansprüche an die Handlungssteuerung und soll mit anderen Varianten der Informationsverarbeitung verbunden werden. Der realitätsorientierte Verarbeitungsmodus befasst sich mit allen Prozessen, die mit der Beratung von Anreizen und Erwartungen Zusammenhängen. Dagegen werden in der realisierungsorientierten Verarbeitungsphase Überlegungen angestellt, wann und wie zur Umsetzung der beabsichtigten Vorgehensweise zu verfahren ist. Es wird zudem davon ausgegangen, dass nach der Entscheidung weitere Überlegungen ausgeschlossen sind - ein Prinzip, das Julius Caesar kurz und bündig mit den Worten „Alea iacta est“1 ausgedrückt hat, als er mit seinen Legionen einen Bürgerkrieg auslöste, in dem sie den Fluss Rubikon überquerten. Das heißt, der Übergang vom motivationalen Überlegungszustand zum willentlichen Umsetzungszustand impliziert einen qualitativen Sprung in Bezug auf die kognitiven Funktionen eines Individuums. (Goschke, 2017, S. 264; Heckhausen & Gollwitzer, 1987, S. 103)
Prädezisionale Handlungsphase (Vor-Entscheidungs- oder Abwägungsphase): In der Vor-Entscheidungsphase werden die einzelnen Wünsche und Anliegen sowie mögliche Handlungsergebnisse miteinander verglichen. Welches Ziel kann eine Person unter welchen Voraussetzungen erreichen, was ist hierfür notwendig? Wenn der Abwägungsprozess vorüber ist, wird das Ergebnis in eine Zielintention umgewandelt. Diese versucht der Handelnde zu erreichen, wodurch ein Gefühl der Verpflichtung für einen selbst entsteht. Zwischen dem Wunsch und dem Ziel liegt der Rubikon, der nun überschritten wird. Dieser Moment wird auch als Fazit-Tendenz bezeichnet. (Achtziger & Gollwitzer, 2006, S. 279; Heckhausen & Gollwitzer, 1987, S. 103)
Präaktionale (postdezisionale) Handlungsphase (Vor-Handlungsphase): In der VorHandlungsphase steht die Umsetzung und Realisierung des in der Abwägungsphase entstandenen Ziels für den Handelnden im Vordergrund. In dieser Phase entstehen Vorstellungen und Pläne, wie das Ziel bestmöglich erreicht werden kann. Eine Ablenkung durch neue Wünsche ist nicht mehr gegeben. Die Phase endet mit einem konkreten Handlungsplan, die als Fiat-Tendenz bezeichnet wird. (Achtziger & Gollwitzer, 2006, S. 280; Heck- hausen& Gollwitzer, 1987, S. 103)
Aktionale Phase (Handlungsphase): In der Handlungsphase versucht der Handelnde seine, in der präaktionalen Handlungsphase, erstellten Entwürfe für die Zielerreichung in die Tat umzusetzen. Die Person stellt eventuell fest, dass es noch Korrekturen bedarf, und ändert entsprechend ihre Pläne so ab, dass diese zur Erreichung des Ziels führen. Das Ziel kann am besten durch Beharrlichkeit und einer Steigerung der Bemühungen bei eintreffenden Problemen vollbracht werden. (Achtziger & Gollwitzer, 2006, S. 280)
Postaktionale Phase (Nach-Handlungsphase): In dieser Phase wird durch den Handelnden sein erzieltes Ergebnis beurteilt. Die Person stellt einen Vergleich zwischen dem in der prädezisionalen Handlungsphase erstellten Ziel und dem erreichten Ziel an. Ist das Individuum mit dem Ergebnis zufrieden, dann analysiert die Person, was gut gelaufen ist und schließt den Prozess ab. Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend war, dann wird geschaut, was anders gemacht werden kann, um das Ziel doch noch zu erreichen. Es kann aber ebenso zu einer Neubewertung kommen, genauso wie das Ziel verworfen werden kann. (Achtziger& Gollwitzer, 2006, S. 281)
1.4 Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Grundlagenfächer mit ihren allgemeinen Theorien und Modellen unentbehrlich für die angewandte Psychologie in der Forschung und dem Berufsalltag sind.
2 Aufgabe B2
In dieser Aufgabe werden allgemeinpsychologische Erkenntnisse der Motivation auf die Lemmotivation angewendet. Dafür ist es zu Beginn notwendig, die Begriffe rund um die Motivation zu definieren. Anschließend wird auf die Motivation im Kontext des Lernens eingegangen, insbesondere wird erläutert, wie die intrinsische Motivation gesteigert werden kann.
2.1 Begriffserklärungen und Formen der Lernmotivation
In der Motivationspsychologie wird versucht, eine ganz bestimmte Frage zu beantworten (Rudolph, 2017, S. 497): Warum legen wir in einer gewissen Situation ein ganz konkretes Verhalten an den Tag? Anders ausgedrückt kann auch gesagt werden, dass die Motivationspsychologie versucht die Art und Weise sowie die Änderung des menschlichen Verhaltens und deren vorausgehende Motive festzustellen. Die Motivationspsychologie erforscht hierbei nicht nur die Unterschiede mehrerer Personen in einer Situation, sondern auch wie sich ein Individuum in verschiedenartigen Gegebenheiten verhält und die Beständigkeit eines Menschen über einen gewissen Zeitraum. (Schmithüsen & Ferring, 2015, S. 67) Bei dieser Definition wird deutlich, dass die Motivationspsychologie ebenfalls Einflüssen aus der Differentiellen und Persönlichkeitspsychologie unterliegt.
Im Folgenden werden die beiden Konstrukte Motivation und Motiv erörtert und voneinander abgegrenzt. Das Wort Motivation wird im Alltag sehr häufig verwendet und verbunden mit Merkmalen, wie Willensstärke, Fleiß, Beharrlichkeit und ähnlichen Eigenschaften (Brandstätter et al., 2013, S. 3). Es stammt von dem lateinischen Verb movere ab, was so viel bedeutet, wie sich zu bewegen oder weiterzuziehen (PONS GmbH). Aus diesem Verb lässt sich der Grundgedanke der Motivation gut erkennen, der Mensch wird angetrieben und möchte sich auf einen gewissen Weg begeben (Dresel & Lämmle, 2011, S. 81). Im Folgenden wird der Begriff der Motivation für Wünsche angewendet, die nur während einer kurzen Zeitspanne unser Inneres zu einem Verhalten ankurbeln. Beispiele hierfür sind: Ich möchte jetzt einen Tee trinken, um meine Gedanken für die bevorstehende Aufgabe zu sortieren, oder ich möchte gerne eine To-Do-Liste anfertigen mit den Aufgaben für die kommende Woche. Motivation in diesem Sinne kann schnell einer Korrektur unterzogen werden und schon stehen andere Dinge im Vordergrund. (Rudolph, 2017,S. 496; Woolfolk, 2008, S. 451)
[...]
1 „Alea iacta est“ ist ein lateinischer Ausdruck und heißt übersetzt so viel wie „Der Würfel ist gefallen!“ (Hänseletal.,2016, S. 99)