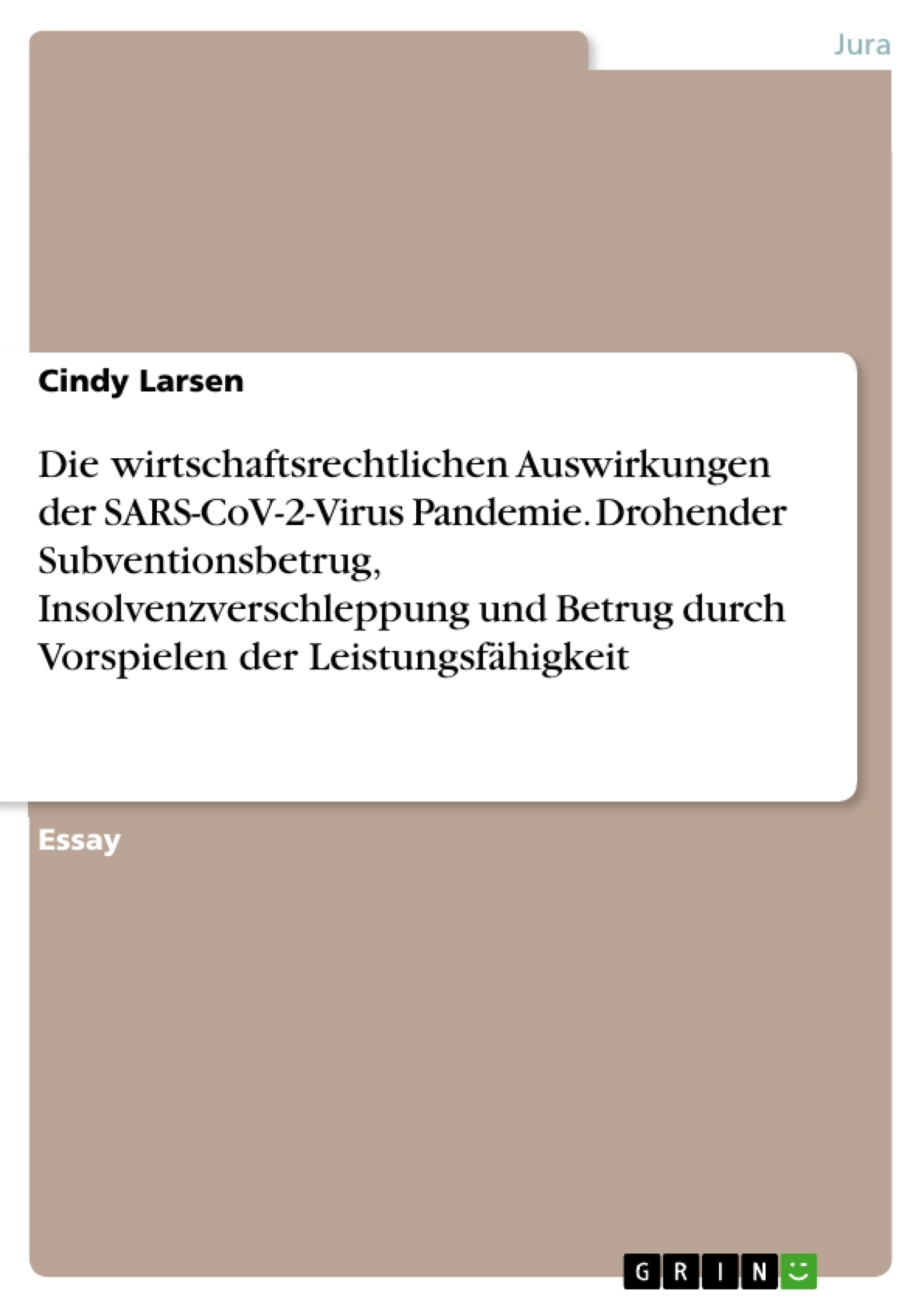Diese Arbeit soll einen Überblick über die strafrechtlichen Risiken aufzeigen, wenn staatliche Soforthilfen im Zuge der SARS-CoV-2-Virus Pandemie unberechtigt in Anspruch genommen oder eine Insolvenz verschleppt wird. Zunächst wird der drohende Subventionsbetrug gemäß § 264 Abs. 1 StGB bei der Antragsstellung auf staatliche Soforthilfen betrachtet. Anschließend wird die drohende Insolvenzverschleppung gemäß § 15a InsO für den Fall, dass die Insolvenzreife einzig auf den Folgen der Ausbreitung des SARSCoV-2-Virus beruht, behandelt. Danach wird auf den drohenden Betrug gemäß § 263 Abs. 1 StGB durch Vorspielen der Leistungsfähigkeit gegenüber Lieferanten und anderen Dienstleistern eingegangen.
Das SARS-CoV-2-Virus, umgangssprachlich Coronavirus genannt, verursacht ab Ende 2019 eine weltweite Pandemie. Anfang Dezember 2019 registrierte ein Arzt in der chinesischen Provinz Wuhan den ersten Patienten mit einer akuten infektiösen Lungenerkrankung beziehungsweise mit einem akuten respiratorischen Syndrom, auf Grundlage einer COVID 19 Infektion. Am 20. Januar 2020 tauchte das Virus erstmals außerhalb Asiens, in Amerika, auf.
Die Ausbreitung des Virus schreitet seitdem fort. Die WHO stufte die SARS-CoV-2-Virus bedingte Infektionswelle am 11. März 2020 als Pandemie ein. Es handelt sich wie bei allen anderen bekannten Coronaviren, um ein behülltes einsträngiges RNS-Virus, das sich über Endozytose oder Membranfusion, unter Zuhilfenahme der vorhandenen ACE2 und TMPRSS2 Proteine bedient, um sich in die Wirtszelle einzuschleusen.
Eine Verlangsamung und eine Eindämmung des Virus können durch Hygiene- und Schutzmaßnahmen erreicht werden. Die Bundesregierung ergreift daher drastische Maßnahmen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes wie beispielsweise Betriebsschließungen. Der Bund und die Länder versuchen durch diverse Maßnahmen, wie zum Beispiel die Soforthilfen, Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen oder Steuerzahlungen und Kurzarbeit, die gravierenden ökonomischen Folgen abzufedern und eine Insolvenzwelle abzuwenden.
Die wirtschaftsrechtlichen Auswirkungen der SARS-CoV-2-Virus Pandemie. Drohender Subventionsbetrug, Insolvenzverschleppung und Betrug durch Vorspielen der Leistungsfähigkeit
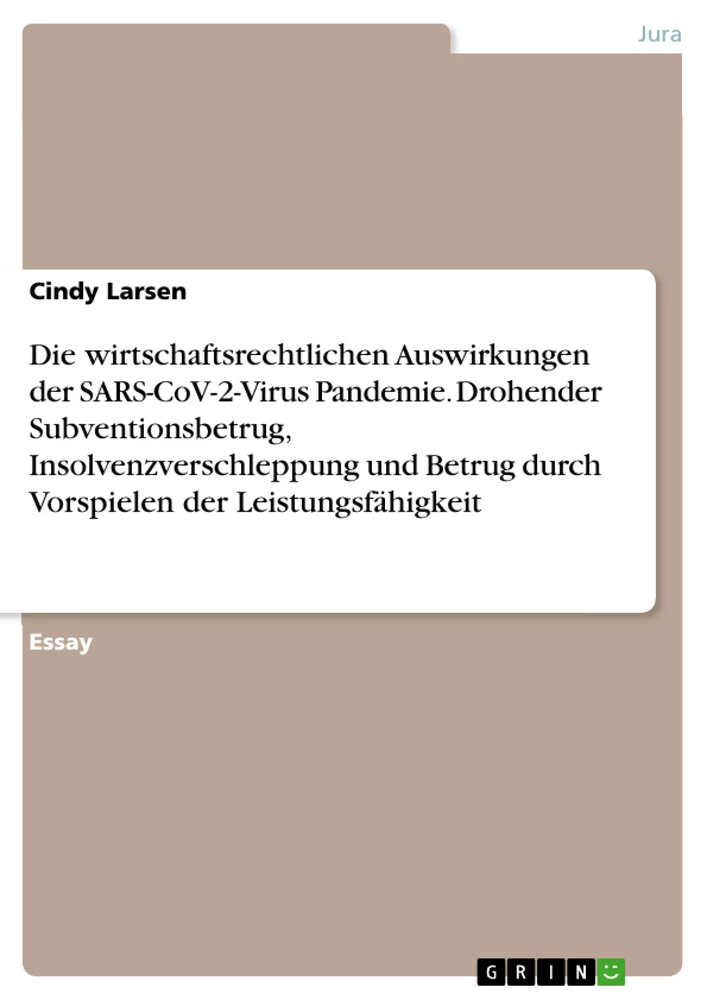
Essay , 2020 , 9 Seiten , Note: 2,0
Autor:in: Cindy Larsen (Autor:in)
Leseprobe & Details Blick ins Buch