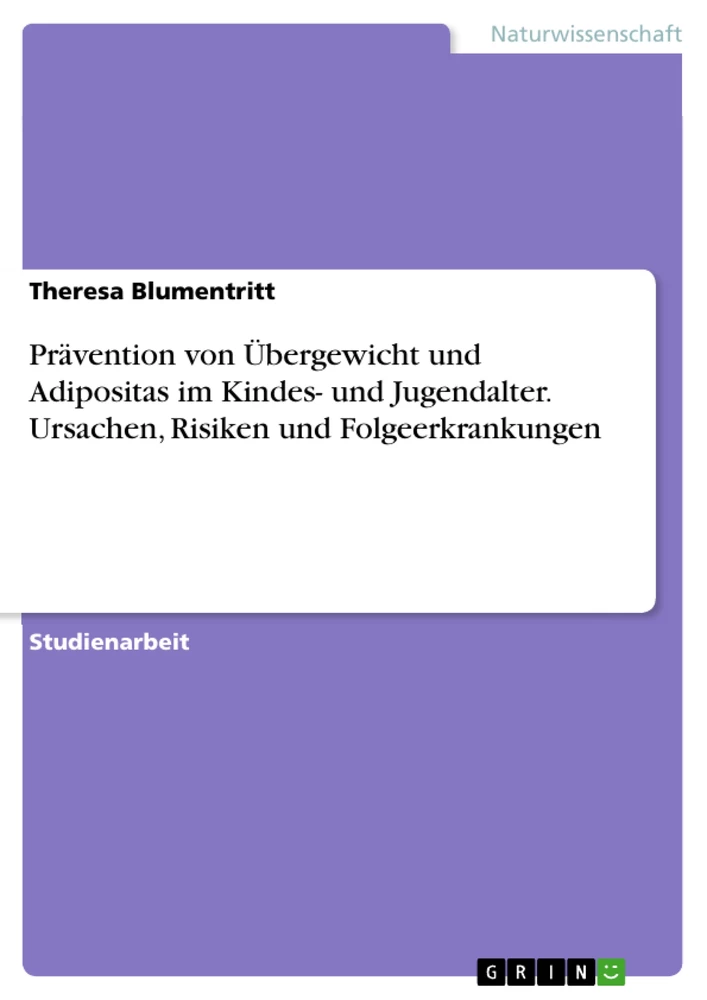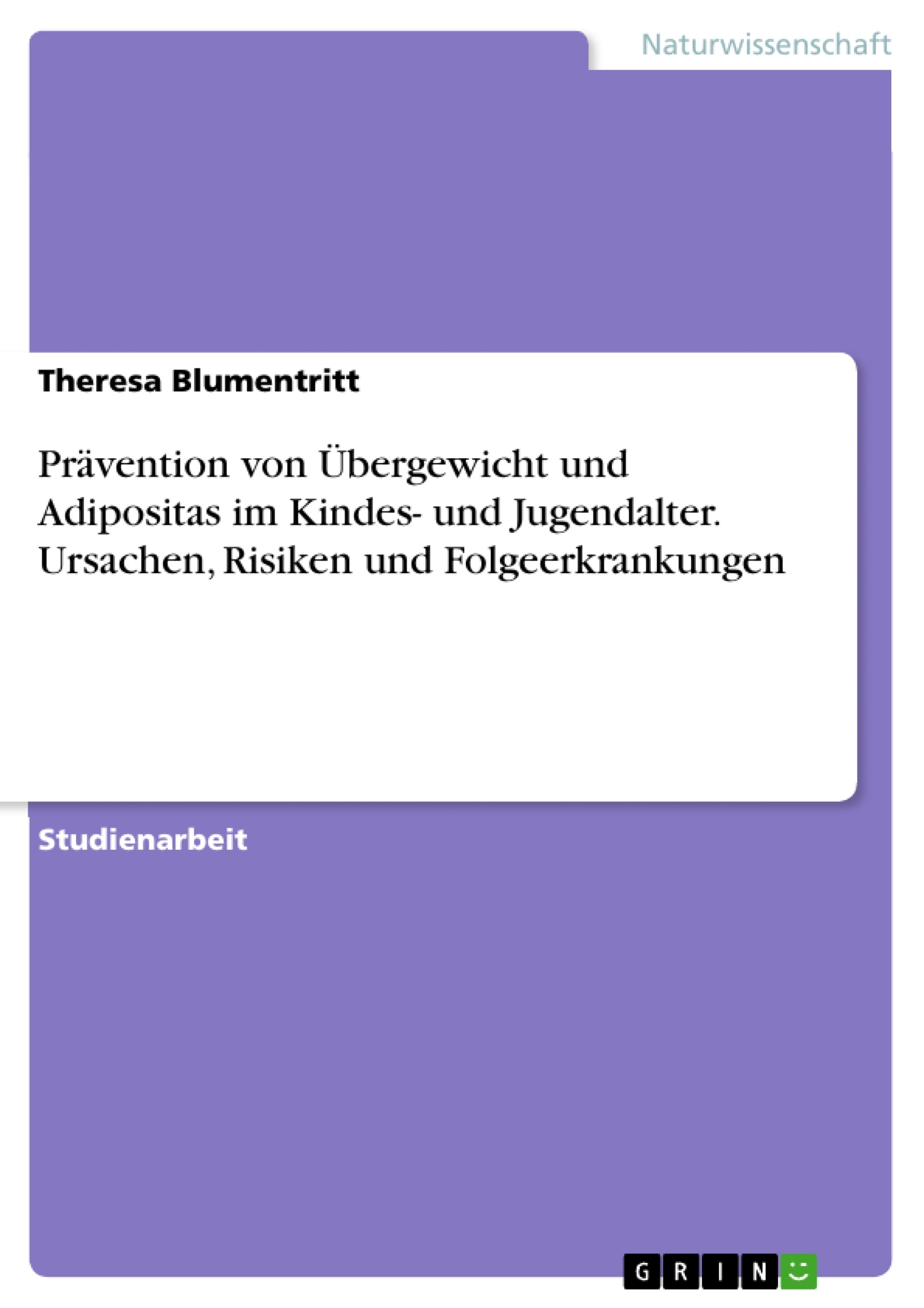In der Arbeit wird die Problematik des Krankheitsbildes Adipositas bei Kindern und Jugendlichen untersucht, indem das Vorkommen, die Entstehungsrisiken und -ursachen sowie die Folgeerkrankungen betrachtet werden. Der Schwerpunkt liegt dabei allerdings darauf, wie man die Adipositas durch Interventionen, auch im Alltag, vorbeugen kann. Dazu wird auch das Präventionspotential untersucht, um die Dringlichkeit der Prävention darzustellen.
Die Adipositas, im Volksmund häufig besser als Fettleibigkeit, Fettsucht oder krankhaftes Übergewicht bekannt, beschreibt einen Zustand, indem der Körperfettanteil gemessen an der Gesamtkörpermasse für das Alter und Geschlecht pathologisch, also gesundheitsgefährdend erhöht ist. Die Gründe für eine Adipositas können vielfältig sein, am häufigsten ist jedoch eine über einen längeren Zeitraum hinweg positive Energiebilanz, was so viel bedeutet, dass zu viel Energie zum Beispiel in Form von Nahrung aufgenommen wird, dies jedoch nicht in ausreichendem Umfang durch Grundumsatz, Thermogenese und Aktivität verbraucht wird. Dies wiederum führt zu der Anlagerung von Fettgewebe im Körper.
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitun
2. Methodisches Vorgehen
3. Ursachen und Risikofaktor
4. Präventionspotent
5. Präventi
6. F olge-/ Begleiterkrankun
7. Therapi
8. Diskussion/ Faz
Literaturverzeichni