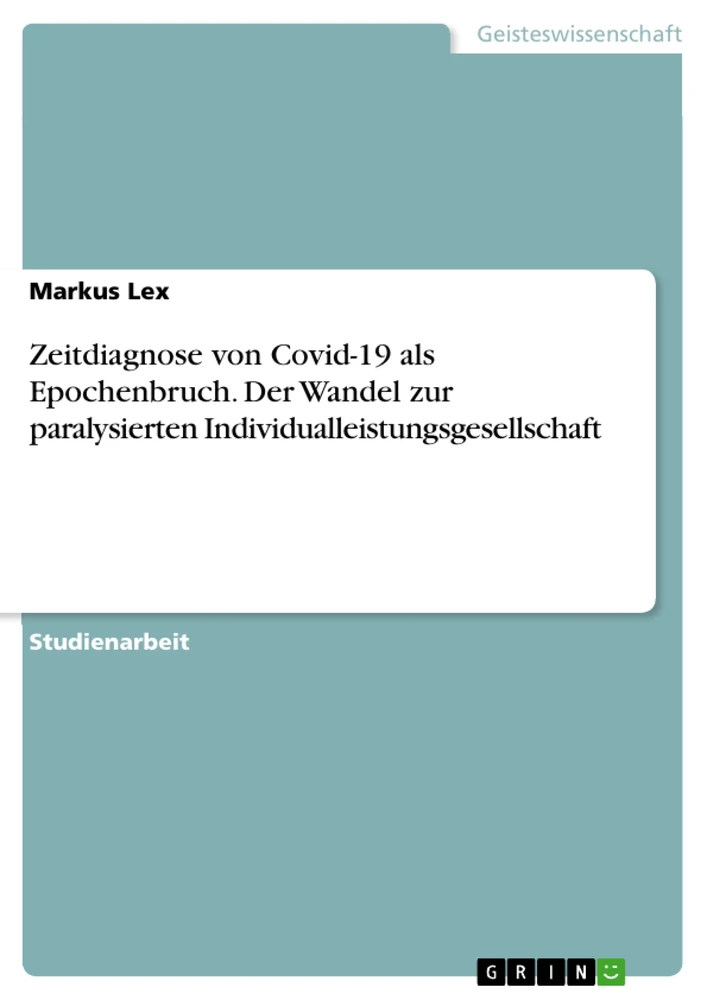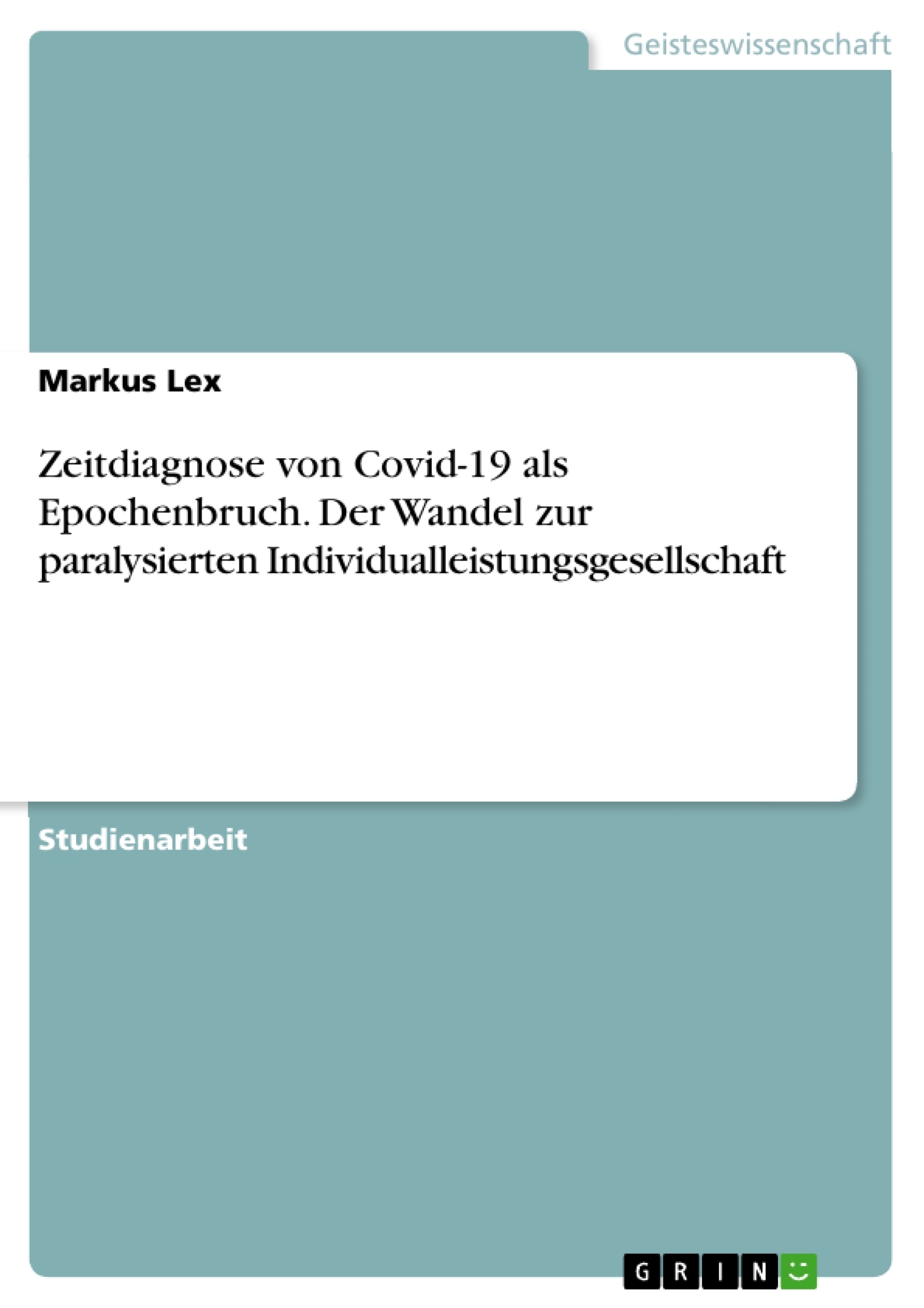In dieser Arbeit stellen sich unter anderem die Fragen: Wann verändert sich eine Gesellschaft? Welche Ereignisse führen zu einer gesellschaftlichen Veränderung? Wie können diese Veränderungen tatsächlich festgestellt werden?
Das Genre der Zeitdiagnosen bzw. der Gesellschaftsdiagnosen versucht Teile dieser Fragen zu beantworten. Dabei beschreibt BOGNER Zeitdiagnosen wie folgt: „Der Begriff der Zeitdiagnose verweist auf eine Zeit, in der die Gesellschaft im soziologischen Sinne noch gar nicht der ausgewiesene Bezugspunkt der Analyse war.“ Die Frage, wann und wie eine Gesellschaft analysiert werden kann, ist dabei ebenso spannend wie komplex.
Gesellschaften unterliegen einem ständigen Wandlungsprozess. Ein anschauliches historisches Beispiel wäre zum Beispiel die Gesellschaft während der industriellen Revolution. Sie ist nicht vergleichbar mit der heutigen Gesellschaft. Dieser Wandlungsprozess ist in der heutigen Zeit spürbarer denn je. Denn wer hätte gedacht, dass in einem liberalen, demokratischen Land wie Deutschland wochenlange Ausgangssperren möglich wären. Die Veränderung gesellschaftlicher Strukturen unterliegen verschiedener Einflussfaktoren. Aus dem Beispielen gehen dabei zwei Faktoren hervor. Zum einen sehen wir eine komplette andere wirtschaftliche Ausgangslage und unterschiedliche Arbeitsplatzbedingungen zwischen der industriellen Gesellschaft und der heutigen Gesellschaft. Zum anderen kann ein Umweltfaktor wie eine Virus-Epidemie bzw. Pandemie zu einer kompletten (wenn auch temporären?) Umwälzung einer Gesellschaft führen.
Inhaltsverzeichnis
1. ABBILDUNGSVERZEICHNIS
2. EINLEITUNG
1.1 Vorüberlegungen/Fragestellung
1.2 Hypothese
3. HAUPTTEIL: ANALYSE
3.1 Abgrenzung: Gesellschaftsdiagnose, Gesellschaftstheorie
3.2 Die deutsche Gesellschaft vor der Corona-Krise
3.3 Die deutsche Gesellschaft während der Corona-Krise
3.4 Die deutsche Gesellschaft nach der Corona-Krise
3.4.1 Szenario 1: Die veränderte deutsche Gesellschaft (Post-Corona-Gesellschaft)
3.4.2 Szenario 2: Die unveränderte deutsche Gesellschaft
4. Kritische Betrachtung von Gesellschaftsdiagnosen
5. FAZIT
6. LITERATURVERZEICHNIS
1. Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Entstehung der Singularitätsgesellschaft
Abbildung 2: "Corona-Analyse" Münchner Merkur
Abbildung 3: Prozentualer Anteil von "Corona-Artikel"
2. Einleitung
Diese Seminararbeit wurde im Rahmen des Seminars „Soziologische Gegenwartsund Gesellschaftskonstruktionen in der (Post-)Moderne“ verfasst. Zunächst gilt es zu klären, was unter dem Begriff der empirischen Sozialforschung zu verstehen ist. Dabei definiert HÄDER diese wie folgt:
„Unter Empirischer Sozialforschung wird eine Gesamtheit von Methoden, Techniken und Instrumenten zur wissenschaftlich korrekten Durchführung von Untersuchungen des menschlichen Verhaltens und weiterer sozialer Phänomene verstanden.“ (2019: 13)
Gesellschaften unterliegen einem ständigen Wandlungsprozess. Ein anschauliches historisches Beispiel wäre zum Beispiel die Gesellschaft während der industriellen Revolution. Sie ist nicht vergleichbar mit der heutigen Gesellschaft. Dieser Wandlungsprozess ist in der heutigen Zeit spürbarer denn je. Denn wer hätte gedacht, dass in einem liberalen, demokratischen Land wie Deutschland wochenlange Ausgangssperren möglich wären. Die Veränderung gesellschaftlicher Strukturen unterliegen verschiedener Einflussfaktoren. Aus dem Beispielen gehen dabei zwei Faktoren hervor. Zum einen sehen wir eine komplette andere wirtschaftliche Ausgangslage und unterschiedliche Arbeitsplatzbedingungen zwischen der industriellen Gesellschaft und der heutigen Gesellschaft. Zum anderen kann ein Umweltfaktor wie eine Virus-Epidemie bzw. Pandemie zu einer kompletten (wenn auch temporären?) Umwälzung einer Gesellschaft führen.
1.1 Vorüberlegungen/F ragestellung
Nun stellen sich die Fragen: Wann verändert sich eine Gesellschaft? Welche Ereignisse führen zu einer gesellschaftlichen Veränderung? Wie können diese Veränderungen tatsächlich festgestellt werden?
Das Genre der Zeitdiagnosen bzw. der Gesellschaftsdiagnosen versucht Teile dieser Fragen zu beantworten. Dabei beschreibt BOGNER Zeitdiagnosen wie folgt: „Der Begriff der Zeitdiagnose verweist auf eine Zeit, in der die Gesellschaft im soziologischen Sinne noch gar nicht der ausgewiesene Bezugspunkt der Analyse war.“ (Bogner 2018: 9) Die Frage, wann und wie eine Gesellschaft analysiert werden kann, ist dabei ebenso spannend wie komplex.
Nun sollte an dieser Stelle (wäre ich ein tüchtiger und konventionsliebender Student) eine konkrete Fragestellung verschriftlicht werden, die es im Verlauf dieser Arbeit zu beantworten gälte. Stattdessen möchte ich mich selbst auf dem Feld der Gesellschaftsdiagnosen versuchen. BOGNER sieht in seiner Beschreibung von Gesellschaftsdiagnosen den Epochenbruch innerhalb der Moderne als entscheidende Charaktereigenschaft. (vgl. 2018: 15) Nun Maße ich mir an, einen solchen Epochenbruch innerhalb unserer Gesellschaft bzw. Zeit gefunden zu haben: Die Corona-Krise. Weshalb ich folgende Gesellschaftsdiagnose stellen möchte:
Die paralysierte Individualleistungsgesellschaft Möchte man nicht so weit gehen und sich selbst als Soziologen bezeichnen, könnte man dies auch als konkrete Fragestellung formulieren, indem man den Kern einer Gesellschaftsdiagnose untersucht:
Stellt die Corona-Krise einen Epochenbruch dar?
1.2 Hypothese
Welches Ereignis stellt einen tatsächlichen Epochenbruch dar und welches Ereignis scheint nur im ersten Blick ein solcher zu sein? Das vermag vermutlich nur die Zeit und die (soziologische) Geschichtsschreibung festzustellen. Ich versuche im Laufe dieser Arbeit darzustellen, warum die Corona-Krise einen solchen Epochenbruch darstellen könnte. Die Arbeitshypothese lautet demensprechend wie folgt:
Die Corona-Krise stellt einen Epochenbruch dar
3. Hauptteil: Analyse
Nun stellt sich vielleicht die Frage, warum die Corona-Krise als auslösendes Ereignis für einen Epochenbruch zu einer Gesellschaftsdiagnose taugen könnte. Die aktuellen Ereignisse sind nicht nur ein Novum für die junge Generation. Der Großteil der deutschen Gesellschaft hat bislang keine Erfahrungen mit gesamtgesellschaftlichen Krisen wie z. B. Kriegen oder Naturkatastrophen. Unter Letzteren fallen auch Seuchen, die eine große Masse an Menschen betreffen können und damit das gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche System bedrohen können. Aus der Geschichte gehen diesbezüglich Beispiele wie die Pest oder die Cholera hervor, deren Auswirkungen über einen längeren Zeitraum das gesellschaftliche Leben bestimmten. In einem Sammelwerk von VÖGELE bezüglich Epidemien und Pandemien aus historischer Sicht sieht der Herausgeber selbst „die Cholera als Test für die Stabilität bzw. Anfälligkeit einer Gesellschaft in einer Krisensituation.“ (2016:12) Nun könnte man einen Schritt weitergehen und gar argumentieren, dass diese Krisensituationen die jeweiligen Gesellschaften nachhaltig verändert haben.
Das neuartige Corona-Virus trat bei bisherigem Kenntnisstand erstmals in China, genauer in der Provinz Wuhan auf. Es kann dabei zu schweren Verläufen, die das Atmungssystem durch schwere Entzündungen mit einhergehendem Fieber betreffen, kommen. Die Infektion geschieht dabei über eine Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch. (vgl. Robert Koch Institut 2020) Im folgenden Hauptteil wird argumentiert, weshalb die Corona-Krise epochale Auswirkungen auf die Gesellschaft haben könnte. Grundsätzlich sollte jedoch das Wesen einer Gesellschaftsdiagnose zunächst definiert werden.
3.1 Abgrenzung: Gesellschaftsdiagnose, Gesellschaftstheorie
An dieser Stelle bietet es sich an, den Begriff der Gesellschaftsdiagnose bzw. der Zeitdiagnose zu definieren. Allerdings stellt dies bereits die erste Schwierigkeit dar, da es „bislang keine präzise Definition“ (Bogner 2018: 10) dieser Begrifflichkeiten in der Soziologie gibt. Um diese Begrifflichkeiten jedoch in dieser Arbeit präzise verwenden zu können, bedarf es einer Arbeitsdefinition. Diese soll auf Grundlage der bereits häufigen zitierten Monografie von BOGNER „Gesellschaftsdiagnosen - Ein Überblick“ definiert werden. BOGNER schärft dabei den Begriff anhand der Abgrenzung zu dem in der Soziologie geläufigen Begriff der Gesellschaftstheorie. Da BOGNER diese Schärfung auf knapp 13 Seiten vornimmt, stellt das Verfassen einer Arbeitsdefinition durchaus eine anspruchsvolle Hürde dar:
Eine Gesellschaftsdiagnose ist die Hochrechnung bereichsspezifischer Phänomene auf die gesamte Gesellschaft anhand der Suche/Analyse einer Typologie, die eine Gesellschaft am ehesten beschreibt. (Komplexitätsreduktion zur Gesellschaftsbeobachtung) Dabei ist der Gegenstand der Analyse die „Frage nach dem Wesen der Gesellschaft“ (Bogner 2018:11) Ausgangspunkt einer Gesellschaftsdiagnose ist dabei ein „Epochenbruch innerhalb der Moderne“ (Bogner 2018: 15)
Die Abgrenzung zu den Gesellschaftstheorien lässt sich relativ prägnant darstellen. Während die Gesellschaftsdiagnose von einer Komplexitätsreduktion „lebt“, lassen Gesellschaftstheorien keine „zentrale Instanz, die die Gesellschaft im Ganzen repräsentieren könnte“ (Bogner 2018: 12) zu. Eine weitere klare Abgrenzung dürfte die empirische Belegung der Annahmen darstellen. Während Gesellschaftstheorien klare empirische Belege für die Annahmen ins Feld führen, spricht BOGNER gar bei Gesellschaftsdiagnosen von einer „Schwundstufe der Gesellschaftstheorie“ (2018: 10), da diese eben diese Belege nicht bringen (können).
Um einen Epochenbruch darzustellen, sollte ebenfalls der Status Quo vor diesen skizziert werden.
3.2 Die deutsche Gesellschaft vor der Corona-Krise
Bei der Beschreibung der deutschen Gesellschaft empfiehlt es sich, bekannte Gesellschaftsdiagnosen der letzten Jahre zu Rate zu ziehen. Dabei wird impliziert, dass sich die deutsche Gesellschaft nur bedingt von anderen westlichen Gesellschaften unterscheidet. Populäre Versuche westliche Gesellschaften in einer Gesellschaftsdiagnose zu beschreiben, stammen dabei von BECK - „Risikogesellschaft“, RECKWITZ - „Die Gesellschaft der Singularitäten“, SCHULZE - „Die Erlebnisgesellschaft“ oder GROSS - „Multioptionsgesellschaft“.
Dabei möchte ich besonders auf die Gesellschaft der Singularitäten von RECKWITZ eingehen. Die Gesellschaftsdiagnose von RECKWITZ basiert dabei auf der McDonaldisierung und stellt eine Art Gegenentwurf zu dieser Diagnose dar. Die McDonaldisierung ist hierbei als „Vorgang, durch den die Prinzipien der Fast-Food-Restaurants immer mehr Gesellschaftsbereiche in Amerika und auf der ganzen Welt beherrschen“ (Ritzer 2006: 15; zitiert nach Bogner 2018: 136), zu verstehen. McDonald's dient als Exponent eines weltweiten gesellschaftlichen Trends zur Rationalisierung und wird als Beispiel für gesamtgesellschaftliche Phänomene genutzt. So hat die McDonaldisierung Auswirkungen auf alle Lebensbereiche wie Arbeit, Freizeit, Ernährung, Bildung, Medizin, Familie, Sport und so weiter. Laut RITZER ist der Trend zur Rationalisierung negativ zu bewerten. Alle menschlichen Aktivitäten würden im Zuge der Rationalisierung einer Bewertung unterzogen. Letztendlich sei dies der Sieg der Technik oder der Sieg des Toten über das Lebendige.
Die Gesellschaftsdiagnose der Singularitätsgesellschaft von RECKWITZ basiert im Grunde auf dem ständigen Drang der Bewertung im Zuge der Rationalisierungsgesellschaft (McDonaldisierung). So wird allerdings der Faktor Mensch seit den 1970er Jahren wieder wichtiger (vgl. Kern/Schumann 1984, zitiert nach Bogner 2018: 148) und der gesamte Mensch wird im Organisationsprozess gefordert. Hierbei soll der Mensch nicht mehr nur stupide Teilaufgaben übernehmen, sondern Kreativität sowie die emotionalen und kommunikativen Fähigkeiten einbringen. Es sei der Trend zum Besonderen zu erkennen. So sieht RECKWITZ einen Epochenbruch innerhalb der Moderne. Die Rationalisierung wird durch das Besondere ersetzt, die Standardisierung durch das Außergewöhnliche und die Uniformität durch das Außeralltägliche.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Entstehung der Singularitätsgesellschaft
Abbildung 1 skizziert dabei die Entstehung der Singularitätsgesellschaft.
Aus der In- dustriegesellschaft/Bewertungsgesellschaft geht durch Rationalisierung und Steigerung der Effizienz die Spätmoderne Gesellschaft hervor. Aus der Spätmoderne Gesellschaft entwickelt sich sodann die Singularitätsgesellschaft, die sich auf folgende Eigenschaft reduzieren lassen kann. So wird Singularisierungsarbeit in eigener Sache durch die Individuen betrieben. „Es geht heute wieder verstärkt darum, Differenzen deutlich zu machen bzw. herzustellen“ (Bogner 2018: 149) Dabei sind die Triebkräfte der Singularitätsgesellschaft folgende:
1. Der industrielle Kapitalismus wird durch einen Kulturkapitalismus bzw. durch eine Wissensökonomie ersetzt.
2. Die Entwicklung neuer Technologien: Internet, soziale Medien.
3. Postmaterialistische Wertewandel: Das Verlangen nach Selbstverwirklichung, Authentizität und Erlebnissen
Die Singularitätsgesellschaft ist demnach vor allem eine Gesellschaft, die durch die Individualisierung und das Streben nach bestbewerteter Einzigartigkeit der Individuen, ausgezeichnet ist. Dies könnte als Status Quo bevor die Corona-Krise Deutschland erreicht hat beschrieben werden.
[...]