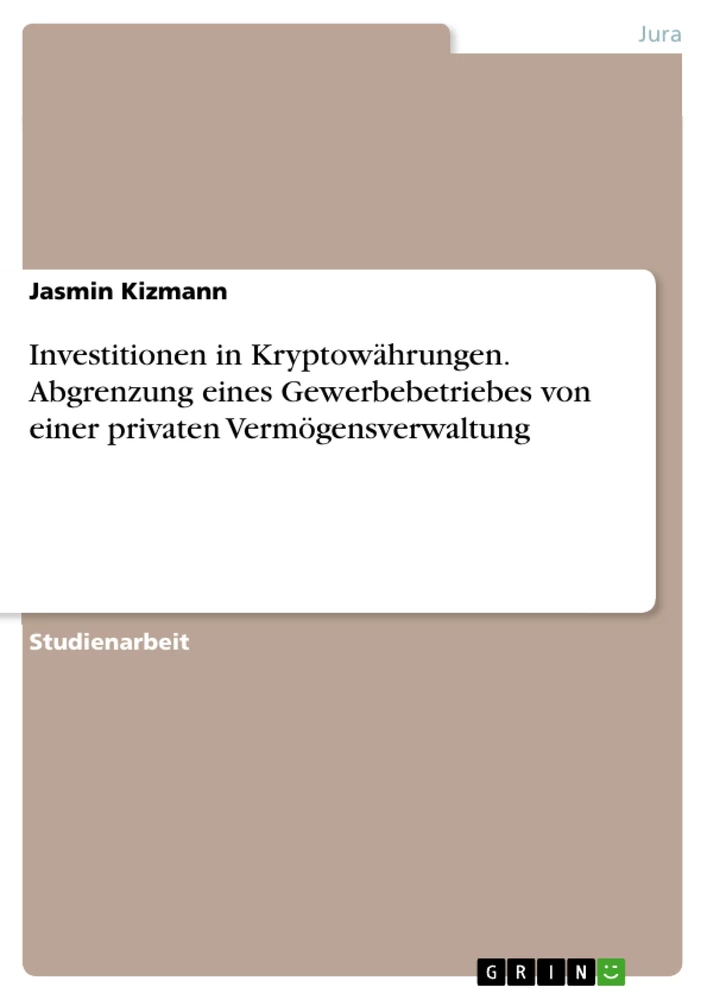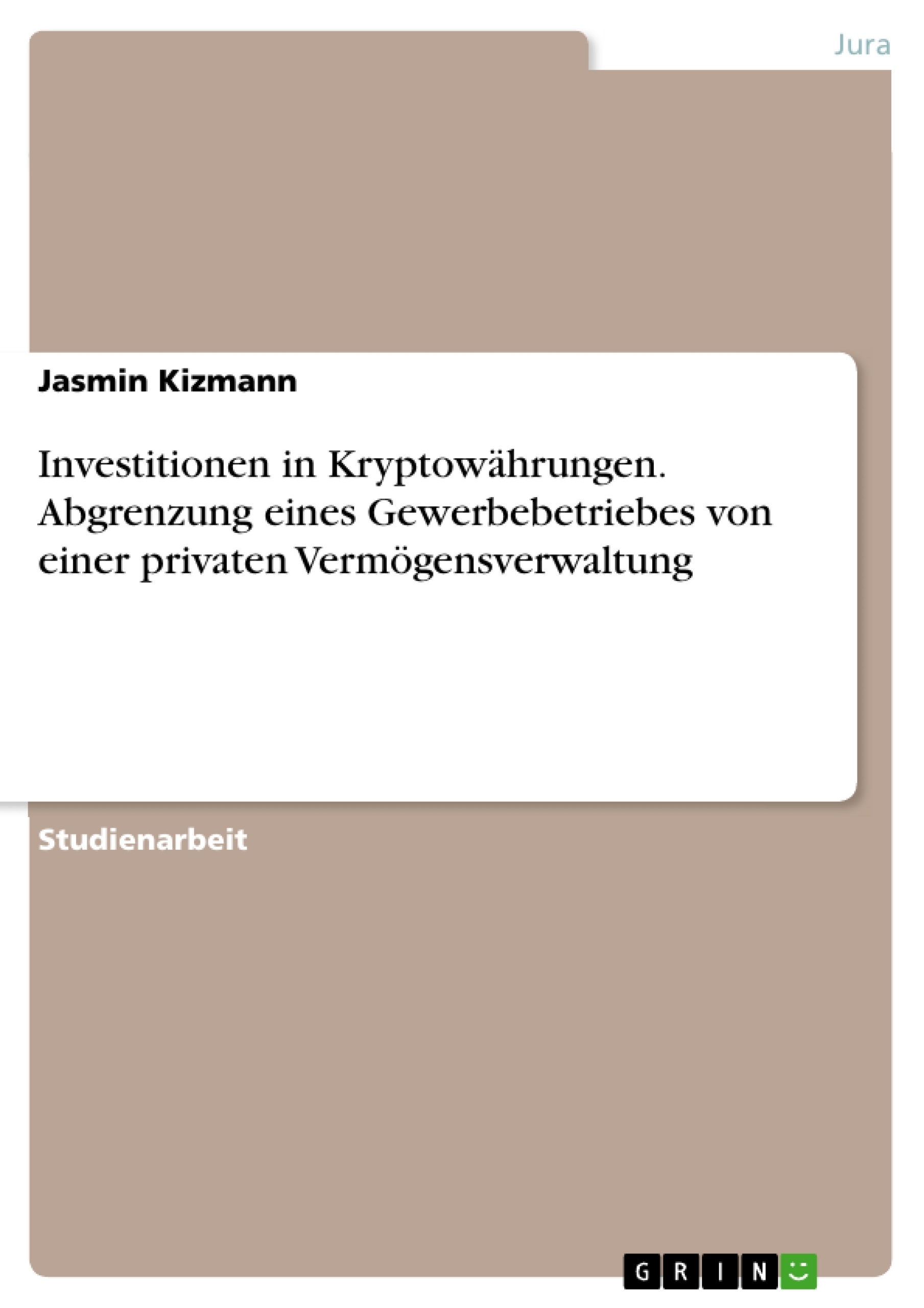Im vergangenen Jahr erlangte der Bitcoin enorm viel mediale Aufmerksamkeit. Fast täglich erschienen Beiträge in der Tagespresse zum Thema Kryptowährungen und Bitcoin. Anleger konnten durch diese digitale Währung teilweise beträchtliche Gewinne erwirtschaften. Die Investitionen in Kryptowährungen sind erheblich gestiegen. Auch wenn dieser Hype mittlerweile etwas abgeflaut ist, was unter anderem mit dem starken Einbruch des Bitcoins im Jahr 2018 zusammenhängt, steigt die wirtschaftliche Relevanz von Kryptowährungen weiterhin an. Es kommt die Frage auf, wie solche neuartigen Investitionstätigkeiten steuerrechtlich zu behandeln sind. Diese Seminararbeit befasst sich mit der Abgrenzung eines Gewerbebetriebs zu einer privaten Vermögensverwaltung bei Investitionen in Kryptowährungen.
Zu Beginn der Arbeit werden Begrifflichkeiten bezüglich Kryptowährungen erklärt. Anschließend wird der Gewerbebetrieb von der privaten Vermögensverwaltung abgegrenzt. Die Kriterien des Gewerbebetriebs werden anschließend anhand von drei Fallbeispielen, welche Bezug auf den Grundstückhandel, den Handel mit Gold sowie den Handel mit Wertpapieren nehmen, erörtert. Im weiteren Verlauf werden Kryptowährungen mit diesen Fallbeispielen verglichen, bevor abschließend ein Blick auf die Finanzverwaltung geworfen wird.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begrifflichkeiten
2.1 Kryptowährungen
2.2 Blockchain
2.3 Abgrenzung von Kryptocoins und Kryptotoken
3. Der Gewerbetrieb und die private Vermögensverwaltung
3.1 Abgrenzung von Gewerbebetrieb und privater Vermögensverwaltung
3.2 Der Grundstückshandel
3.3 Der Goldhandel
3.4 Der Wertpapierhandel
4. Maßstäbe zur Abgrenzung von Kryptowährungen
4.1 Der Grundstückshandel und Kryptowährungen
4.2 Der Goldhandel und Kryptowährungen
4.3 Der Wertpapierhandel und Kryptowährungen
5. Die Finanzverwaltung
6. Fazit
Literaturverzeichnis