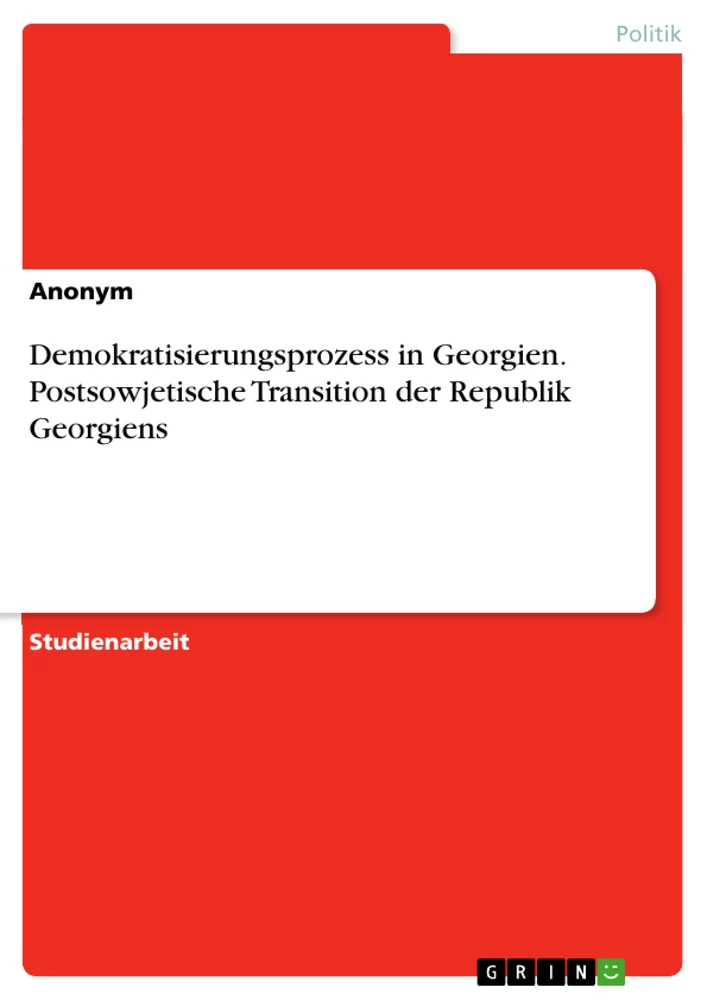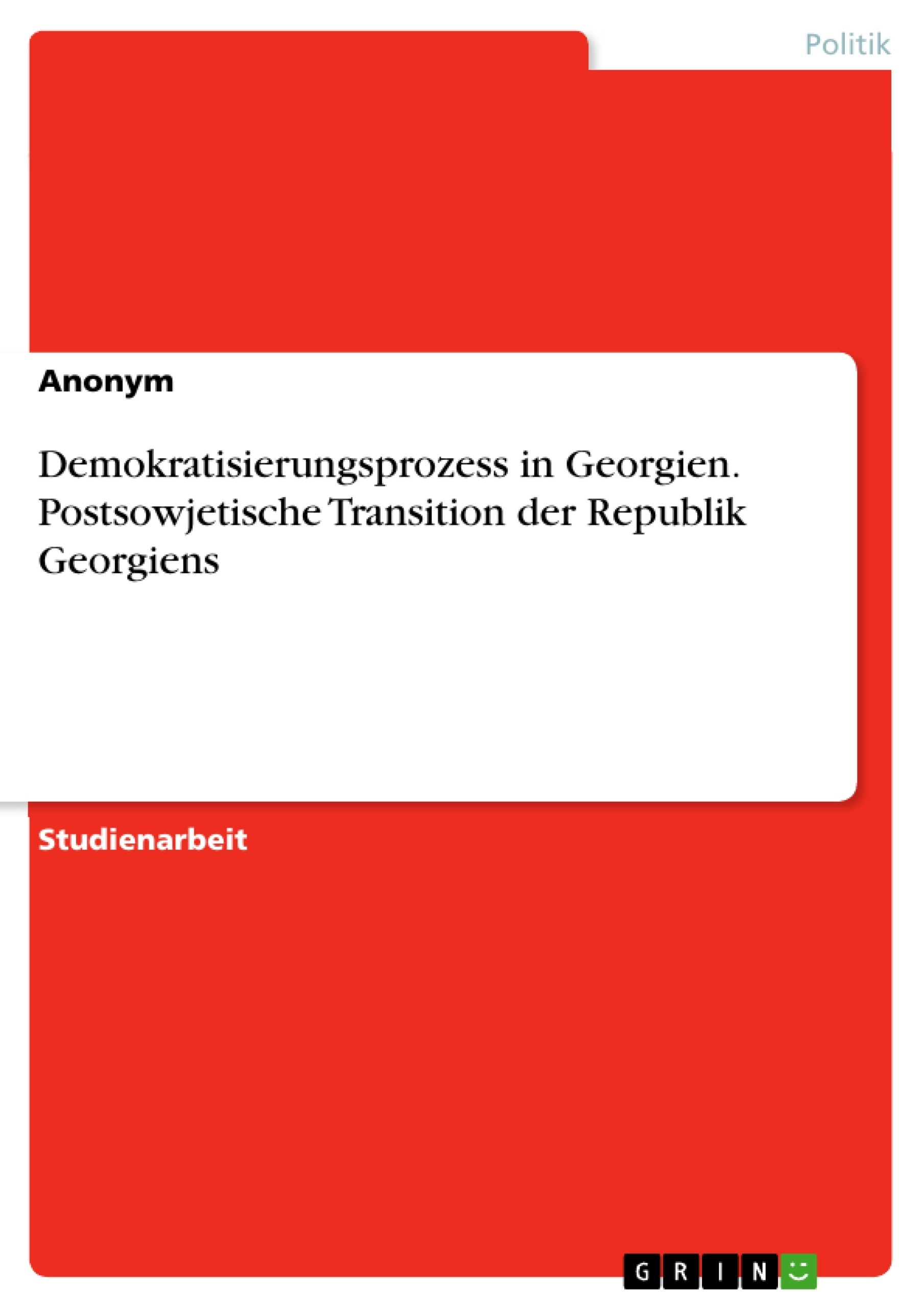Die Arbeit untersucht, inwiefern sich in der Republik Georgien der Grad der Organisation der Parteien auf den demokratischen Transitionsprozess nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ausgewirkt hat. Dabei wird die Parteienlandschaft hinsichtlich der strukturellen Stärke, ihrer Durchsetzungskraft und Entwicklung in den Jahren ab 1990 betrachtet und versucht, zu erläutern, ob ähnlich wie in anderen postsozialistischen Staaten der Organisationsgrad der politischen Parteien für den Erfolg der Transformation von einem autokratischen zu einem demokratischen System wichtig war. Die Ergebnisse zeigen, dass sich in Georgien die schwach ausgeprägte und schlecht organisierte Parteienland zunächst negativ auf den Demokratisierungsprozess ausgewirkt hat, aber mit der Genese dieser Strukturen in Folge der Rosenrevolution eine positive Entwicklung für den weiteren Verlauf der Demokratisierung zu beobachten war.
Inhaltsverzeichnis
1 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
2 Einleitung
3 Allgemeine Einführung zur (postsozialistischen) Transformation
4 Theoretischer Rahmen
5 Operationalisierung und Analysemethode
6 Empirische Analyse
7 Fazit
8 Literaturverzeichnis