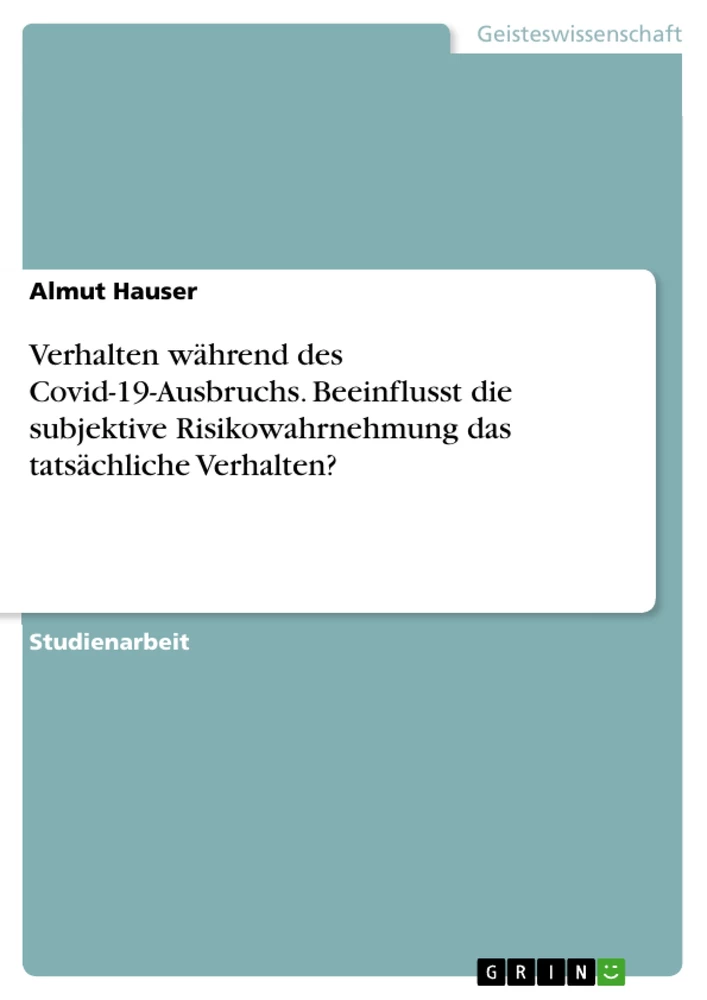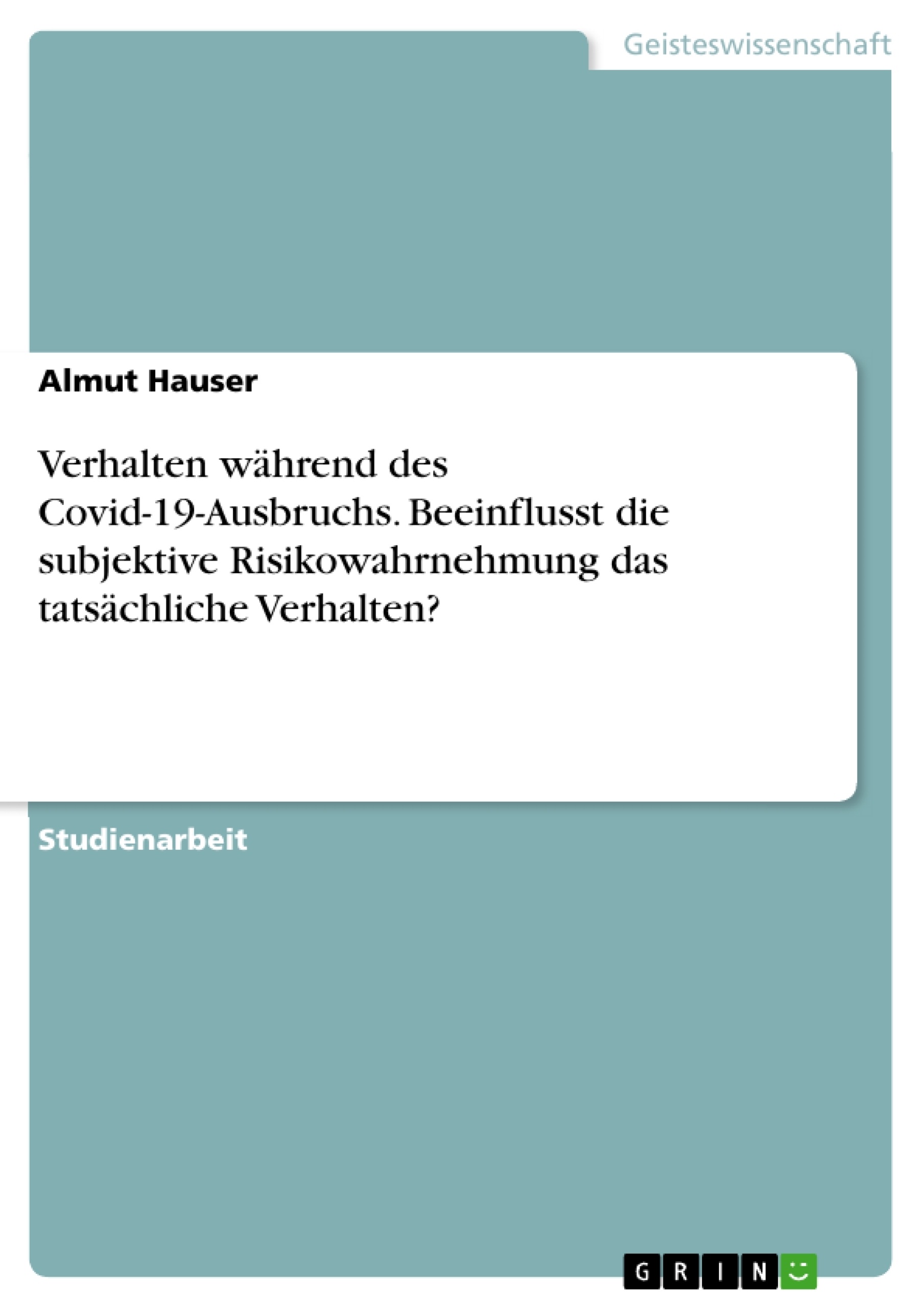Seit dem COVID-19-Ausbruch befindet sich die Welt in einer Art Notfallsituation. In dieser Arbeit wird untersucht, ob je nach Risikowahrnehmung von COVID-19 das Verhalten des Haus-Verlassens für Sozialkontakte beziehungsweise Krankheitsversorgung variiert. Dies geschieht im Rahmen einer Studie als Kooperationsprojekt der Universität Mailand mit der Universität Surrey in einer Umfrage mit 438 Teilnehmern innerhalb der deutschen Bevölkerung. Außerdem wird der Frage nachgegangen, ob bei Personen mit hoher Risikowahrnehmung hinsichtlich der Umsetzung der empfohlenen Ausgangsbeschränkungen Geschlechtsunterschiede bestehen.
Der weltweite Ausbruch der neuen Atemwegserkrankung COVID-19, der in China zum ersten Mal im Dezember 2019 in Wuhan bestätigt wurde, hat in zahlreichen Ländern der Welt zu massiven Einschnitten im öffentliche Leben, aber auch im Privatleben vieler Bürger geführt. Maßnahmen des Social Distancing, also des Vermeidens eines direkten Körperkontakts und des Abstandhaltens zu anderen Personen, wurden ergriffen, um eine weitere Verbreitung von Erregern einzudämmen oder zumindest zu verlangsamen.
Gleichzeitig wurde das Thema COVID-19 in sehr unterschiedlicher Form in der Öffentlichkeit kommuniziert. Die Spanne reicht von sachlicher, wissenschaftlich begründeter Information, über Nachrichten mit erschreckenden Bildern überfüllter Krankenhäuser in Italien bis hin zu Verharmlosung oder gar Verleugnung der Gefährlichkeit durch Regierungschefs wie Trump, Bolsonaro und Lukaschenko.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Zusammenfassung
1 Einleitung
2 Theorie
2.1 Theoretische Konzepte
2.1.1 Risiko und Risikowahrnehmung
2.1.2 Umgang mit Risiko: Verhalten
2.2 Bisherige Studien zu COVID-19
2.3 Forschungsfragen
3 Methode
3.1 Stichprobe
3.2 Instrument
3.3 Durchführung
3.4 Operationalisierung
3.5 Empirische Hypothesen
4 Ergebnisse
5 Diskussion
6 Fazit
7 Literaturverzeichnis
Anhang: Fragebogen zur Untersuchung relevanten Verhaltens während des Covid-19-Ausbruchs, deutsche Version