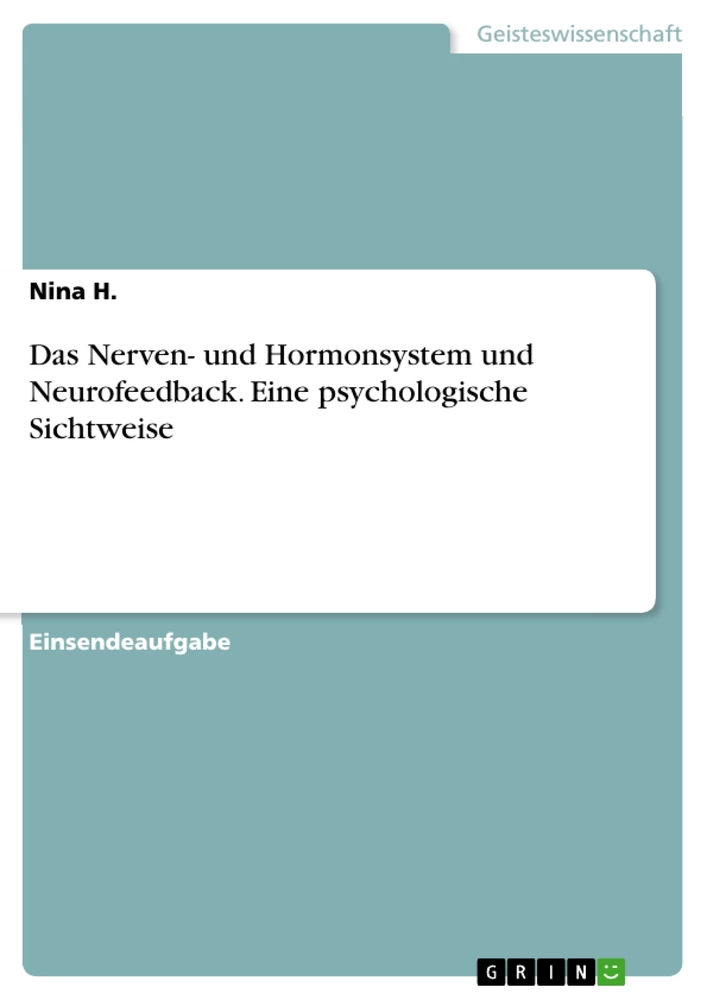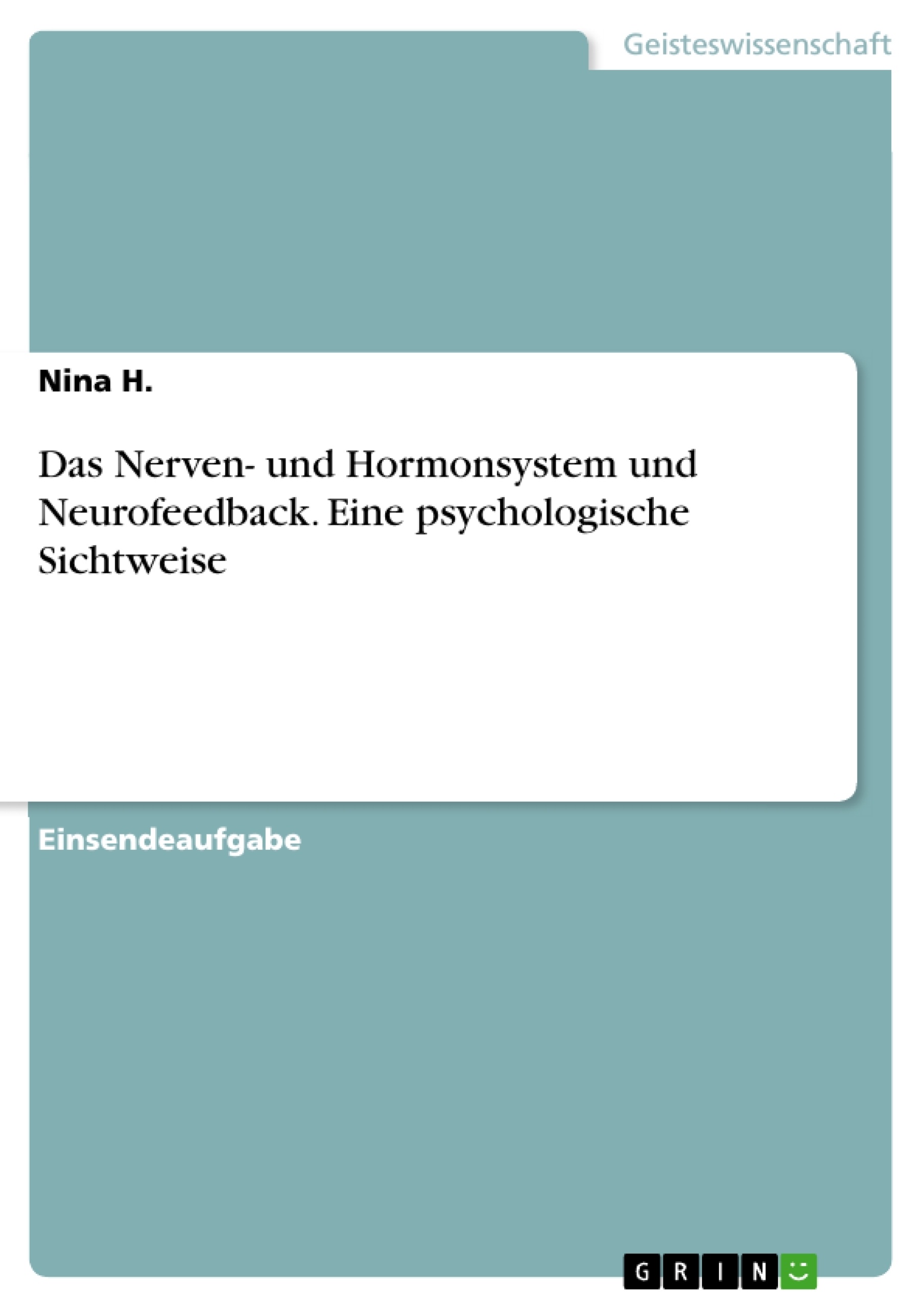Diese Arbeit gibt einen Einblick zum Hormon- und Nervensystem, bevor die Thematik "Neurofeedback" detailliert dargestellt wird.
Egal, ob das Hormonsystem oder das Nervensystem - der Körper hat direkte und indirekte Effekte auf die menschliche Psyche. Die biologische Psychologie beschäftigt sich daher mit Ursachen und Wirkungen auf der physischen Ebene, die Zusammenhänge zu psychischen Prozessen aufweisen.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Genderhinweis
Das Nervensystem
Das Hormonsystem
Neurofeedback
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Ebd. Ebenda
et al und Andere
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Organverbindungen und Vorgänge der Signalstoffe 11
Genderhinweis
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Einsendeaufgabe eine einheitliche Sprachform verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung eines Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.
Das Nervensystem
Der Unterschied zwischen dem somatischen und dem vegetativen Nervensystem
Das Nervensystem ist verantwortlich für die Verbindung zwischen reizaufnehmenden und reizbeantwortenden Organen und die dementsprechende Informationsverarbeitung. 1 Seine Aufgabe ist es, durch diese Vorgänge, Bewegungen und Organfunktionen zu steuern. Zudem gilt es als Sitz des Gedächtnisses, des Denkens, der Empfindungen und des Bewusstseins. 2 Dieser Prozess durchläuft mehrere Schritte. Die Rezeptoren des Körpers registrieren Reize, welche vom Nervensystem aufgenommen werden. Dieses wandelt die Reize in Impulsfolgen um und leitet sie an reizbeantwortende Organe sog. Erfolgsorgane weiter. Interaktionen zwischen dem Lebewesen und der Außenwelt aber auch zwischen den einzelnen Teilen des Lebewesens werden vom Nervensystem geregelt und eingehende sowie ausgehende Informationen weitergegeben und verarbeitet. Folglich kann das Nervensystem als Überwachungs- und Regulationsorgan bezeichnet werden. 3 Bei Wirbeltieren, zu denen neben den Menschen u.A. Beuteltiere, Vögel, Reptilien, Haie und Rochen zählen, 4 kann das Nervensystem topografisch in das zentrale Nervensystem (ZNS) und das periphere Nervensystem (PNS) eingeteilt werden. 5 ZNS sowie PNS werden nachfolgend genauer erläutert.
Das ZNS besteht aus dem Gehirn und dem Rückenmark, dessen Leitungsbahnen die verschiedenen Zentren miteinander verbinden und die sog. peripheren Nerven bilden, die zu den Organen hin und von den Organen wegführen. 6 Aufgabe des Gehirns ist es, Informationen auszuwerten und eine dementsprechende Reaktion wie bspw. eine Anpassung der Organfunktionen oder eine Bewegung zu veranlassen. Das Gehirn arbeitet hier mit sog. „höheren Funktionen“ wie u.A. dem Erinnern, dem Denken, dem Fühlen.7 Aufgabe des Rückenmarks ist es, Informationen aus der Peripherie zum Gehirn zu leiten und umgekehrt. Zudem werden über das Rückenmark Reflexe generiert, bei denen das Gehirn nicht einbezogen wird. 8 Gemeinsam stellen Gehirn und Rückenmark sie die sog. Leitungsbögen dar, von denen jeder aus einem afferenten (zuleitendem) bzw. sensorischen und einem efferenten (wegführendem) bzw. motorischen Schenkel besteht. 9 Weitere Bestandteile des ZNS (unabhängig von der Aufteilung Gehirn und Rückenmark) sind das Großhirn, Kleinhirn, Hirnstamm, Armgeflecht, Grenzstrang des Sympathikus, Spinalnerven und das Sakralgeflecht. 10 Dabei lassen sich zwei Bereiche am Nervengewebe des ZNS unterscheiden: die weiße und die graue Substanz. Hirnrinde und -kerne sowie Vorder-, Seiten- und Hinterhörner des Rückenmarks bilden eine graue Substanz und bestehen aus Nervenzellkörpern. 11 Die graue Substanz im ZNS wird Rinde (Cortex) oder Kern (Nucleus) bezeichnet. 12 Marklager des Gehirns sowie ab- und aufsteigende Nervenbahnen des Rückenmarks bestehen aus einer weißen Substanz, den sog. Nervenfasern 13 und werden als Bahnen bezeichnet. 14
Das PNS umfasst alle neuronalen Strukturen, die außerhalb des ZNS liegen 15 wie bspw. Hirnnerven, Spinalnerven und periphere Nerven 16 und ist für die Weitervermittlung der Informationen aus der Peripherie an das ZNS bzw. umgekehrt zuständig. 17 Auch das PNS besteht aus grauer und weißer Substanz. Die weiße Substanz entspricht dabei den Nerven, die graue Substanz Ganglionen. 18
Funktionell gesehen besteht das gesamte Nervensystem (ZNS sowie PNS) aus einem somatischen und einem autonomen (vegetativen) Teil. Das somatische Nervensystem kontrolliert dabei reflexartige und willkürliche Bewegungen des Körpers und damit die Skelettmuskulatur. Das autonome Nervensystem hingegen steuert unwillkürliche Organfunktionen. 19
Somatisches wie auch autonomes Nervensystem bestehen, rückwirkend erklärt, jeweils aus einem zentralen und einem peripheren Teil. 20 Dabei interagiert das somatische Nervensystem, das auch skelettales Nervensystem genannt wird, 21 mit der Umwelt und umfasst einerseits alle Rezeptoren der Haut, Gelenke, Augen, Ohren und die sensorischen Rezeptoren der Skelettmuskulatur sowie die Vermittlung dieser Informationen an das ZNS und andererseits die Übermittlung jeglicher Signale, die vom ZNS an die Skelettmuskulatur übertragen werden müssen. Die Signalübertragung vom ZNS zur Peripherie (Output) erfolgt über sog. efferente Nerven (efferent = weg vom ZNS) und die umgekehrte Übermittlung von Signalen (Input) über sog. afferente Nerven (afferent = hin zum ZNS). 22 Somatische Nerven werden für bewusst gesteuerte Bewegungsabläufe oder Körperfunktionen benötigt. 23 Sie stehen somit unter der willentlichen Kontrolle des Lebewesens. 24
Das autonome Nervensystem hingegen befasst sich mit der Regulierung der Organe (Herz, Lunge, Magen-Darm-Trakt, Gefäße, Drüsen) auf neuronaler Ebene wie bspw. der Atmung, dem Puls, der Verdauung, der Temperatur, dem Kreislauf, dem Wachstum, der Fortpflanzung, dem Schlaf und der Leistung. Das autonome Nervensystem steuert also unbewusste Bewegungsabläufe oder Körperfunktionen 25 und steht somit nicht unter willentlicher Kontrolle des Lebewesens. 26 Ziel des autonomen Nervensystems ist es einen balancierten Zustand zu erreichen und diesen zu halten. Dieser Zustand wird als Homöostase bezeichnet. 27 Hierbei wird unterschieden zwischen afferenten Nerven, die dem ZNS Signale von den inneren Organen übermitteln und efferenten Nerven, die den Organen Informationen vom ZNS zukommen lassen. Die efferenten Nerven werden unterteilt in den Sympathikus und den Parasympathikus also in sympathische und parasympathische Nerven. 28 Unter normalen Bedingungen versuchen Sympathikus und Parasympathikus gemeinsam für die oben bereits erwähnte Homöostase zu sorgen. 29 Ist das Lebewesen in Gefahr, so veranlasst der Sympathikus den Körper dazu aktiv zu werden und bereitet ihn auf eine fight or flight reaction, also auf kämpfen oder fliehen, vor. Damit steuert der Sympathikus lebensnotwendige Vorgänge 30 und kommt dann zum Einsatz, wenn der Körper durch Außenreize erregt wurde (körperliche Arbeit, Reaktion auf Stressreize). Diese Arten von Aktivitäten werden als ergotrop (=erregend) bezeichnet. 31 Topografisch entspringen seine Neuronen den Seitenhörnern der Rückenmarksegmente C8-L2. 32 Beispiele für ergotrope Aktivitäten des Sympathikus wären die Erweiterung der Arterien und der Bronchien, die Aktivierung bestimmter Drüsen zur Hormonausschüttung bspw. Adrenalin, die Beschleunigung des Herzschlages oder die Erhöhung des Blutzuckerspiegels. 33 Im Gegensatz zum Sympathikus ist der Parasympathikus dann aktiv, wenn das Lebewesen sich im Ruhezustand befindet und sich entspannt. Dabei werden Energiereserven aufgebaut. 34 U.A. setzt der Parasympathikus beim Essen, der Verdauung und dem Ausscheiden sog. trophotrope (=beruhigend) Aktivitäten ein. Dies sind alles Körperfunktionen, die nach innen gerichtet sind. 35 Topografisch gesehen, entspringt der Parasympathikus den Kerngebieten der Hirnnerven 3, 7, 9 und 10 aber auch den Seitenhörnern der Rückenmarksegmente S2-S4. 36 Beispiele für trophotrope Aktivitäten, die durch den Parasympathikus ausgelöst werden, sind die Verminderung des Herzschlags, Beruhigung der Atmung, Aufbau von neuen Energiereserven und die Absenkung des Blutzuckerspiegels. 37
Wie bereits erwähnt, arbeiten Parasympathikus und Sympathikus meist nicht zeitgleich, sondern je nachdem welcher Vorgang gerade benötigt wird, um möglichst nahe am Gleichgewichtszustand zu landen. Es werden jedoch Sonderfälle beobachtet, die Ausnahmen diesbezüglich darstellen. So kann es bspw. dazu kommen, dass während einer Erregungssituation, die von Angst geprägt ist, eine vom Parasympathikus veranlasste Blasenentleerung stattfindet. Ein anderes Beispiel bietet die männliche Erregung. Hier startet der Parasympathikus mit der Erektion und wird anschließend vom Sympathikus durch die Ejakulation abgelöst. Damit kann von den beiden Systemen als sehr präzise aufeinander abgestimmte Prozesse gesprochen werden, jedoch nicht immer von antagonistisch. 38
Das Hormonsystem
Die Funktion von vier verschiedenen Hormonen, die von der Hypophyse ausgeschüttet werden
Das menschliche Drüsensystem des Menschen umfasst zwei Arten von Drüsen im Körper. Einerseits die exokrinen Drüsen und andererseits die endokrinen Drüsen. Die exokrinen Drüsen haben Gänge, durch welche z.B. Schweiß oder andere Substanzen nach außen dringen können. Die endokrinen Drüsen haben hingegen keine Gänge. Die Substanzen, die durch das endokrine System ausgeschüttet werden, werden Hormone genannt und gelangen direkt über das Blut ins Kreislaufsystem eines Lebewesens. 39 Als „endokrines System“ werden nicht nur alle Organe, die Signalstoffe produzieren, die entweder selbst eine Wirkung entfalten (autokrine oder parakrine Wirkung) oder durch den Blutkreislauf weitergegeben werden, um in einer Zielzelle ihre Wirkung zu entfalten (endokrine Wirkung) gezählt, sondern auch alle im Körper verstreut liegenden Zellen, die dieselben Funktionen erfüllen. 40 Für die Hormonausschüttung des endokrinen Systems sind verschiedene Organe wie bspw. das Gehirn mit dem Hypothalamus und der Hypophyse, die Schilddrüse, die Keimdrüsen und die Bauchspeicheldrüse zuständig. 41 Wie bereits erwähnt wurde, werden bei der endokrinen Wirkung Signalstoffe ins Blut abgegeben, um in einer Zielzelle eine Wirkung hervorzurufen. Der Ablauf dieses Vorgangs wird im nachfolgenden Absatz näher erläutert.
Signalübertragung: Hypothalamus-Hypophysen-Achse
Im Gehirn sitzen sowohl die Hypophyse als auch der Hypothalamus als zwei Gehirnteile, die für die Regulierung und somit Freisetzung der meisten Hormone zuständig sind. 42 Die Hypophyse wird auch Hirnanhangdrüse genannt und ist etwa kirschkerngroß. Sie liegt direkt hinter der Kreuzung der beiden Sehnerven in etwa zwischen den Augen und unterhalb des Gehirns. Zudem besteht sie aus zwei Teilen: dem Hypophysenvorderlappen, auch Adenohypophyse genann und dem Hypophysenhinerlappen, der auch Neurohypophyse genannt wird. Vergleicht man die beiden Teilen in ihrer Masse, so macht der Vorderlappen ca. 60 % aus.
Die Verbindung zwischen Hypophyse und Hypothalamus bildet der Hypophysenstiel über welchen die Signalstoffe weitergegeben werden. 43
Erhält das Gehirn die Information, dass ein bestimmtes Hormon freigesetzt werden soll, aktiviert sich der Hypothalamus in dem er ein freisetzendes Hormon (sog. Releasing-Hormon) ausschüttet. 44 Diese Reaktion erfolgt durch gesammelte Informationen von äußeren Faktoren wie bspw. Eindrücken von Sinnesorganen, Stress, dem Tag- und Nachtrhythmus oder inneren Faktoren, die vom Körper selbst stammen. 45 Das Releasing-Hormon informiert anschließend die Hypophyse darüber, welches Hormon der Körper in diesem Moment benötigt. Im nächsten Schritt schüttet die Hypophyse ein glandotropes (= auf die Drüse einwirkendes) Hormon frei. Dieses Hormon hat, wie der Name schon sagt, eine Drüse als Zielort. Die Zieldrüse selbst, bildet letztendlich das Hormon, das vom Körper benötigt wird. Dieses wird effektorisches Hormon genannt und hat eine Wirkung auf bestimmte Organe des Menschen. Ist der gewünschte Spiegel dieses speziellen Hormons erreicht worden, so sinkt die Produktion des Hormons in der Drüse wieder ab. Dieser Vorgang wird als negative Rückkopplung bezeichnet. Die beiden Gehirnteile Hypothalamus und Hypophyse sind funktionell hintereinandergeschaltet, was bedeutet, dass die Abfolge immer von Hypothalamus auf Hypophyse folgt. 46 Dem Hypothalamus stehen vier Releasing-Hormone zur Verfügung: CRH (Corticotropin-Releasing-Hormon), GnRH (Gonadotropin-Releasing-Hormon), GHRH (Growth-Hormone-Releasing-Hormon) und TRH (Thyreotropin-Releasing-Hormon). Der Hypothalamus kontrolliert das Hormongeschehen im Körper und wählt das passende Hormon je nachdem welches benötigt wird. Durch die Wahl des Releasing-Hormons wird bestimmt, welches glandotrope Hormon von der Hypophyse ausgeschüttet wird: 47
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S. 33
2 Vgl. Thieme (2015a)
3 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S. 33
4 Vgl. Spektrum (1999)
5 Vgl. Karim/Eck (2015), S. 25
6 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S. 33
7 Vgl. Thieme (2015b)
8 Vgl. Thieme (2015c)
9 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S. 33
10 Vgl. Ebd., S. 43
11 Vgl. Thieme (2015a)
12 Vgl. Schünke/Schulte/Schumacher/Prometheus (2014)
13 Vgl. Thieme (2015a)
14 Vgl. Schünke et al. (2014)
15 Vgl. Karim/Eck (2015), S. 26
16 Vgl. Thieme (2015a)
17 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S: 43
18 Vgl. Schünke et al. (2014)
19 Vgl. Thieme (2015a)
20 Vgl. Thieme (2015a)
21 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S: 43
22 Vgl. Karim/Eck (2015), S. 26
23 Vgl. Spektrum (1999a)
24 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S. 43
25 Vgl. Spektrum (1999a)
26 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S. 44
27 Vgl. Spektrum (2000)
28 Vgl. Spektrum (1999a)
29 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S. 44 (Becker-Carus & Wendt, 2017)
30 Vgl. Spektrum (1999a)
31 Vgl. Zalpour (2006), S. 213
32 Vgl. Bommas-Ebert/Teubner/Voß (2011)
33 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S. 44
34 Vgl. Karim/Eck (2015), S. 26
35 Vgl. Zalpour (2006), S. 213
36 Vgl. Bommas-Ebert et al. (2011)
37 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S. 44
38 Vgl. Ebd.
39 Vgl. Karim/Eck (2015), S. 47
40 Vgl. Thieme (2019)
41 Vgl. Karim/Eck (2015), S. 47
42 Vgl. Thieme (2018)
43 Vgl. Droste (2009)
44 Vgl. Thieme (2018)
45 Vgl. Droste (2009)
46 Vgl. Thieme (2018)
47 Vgl. Ebd.