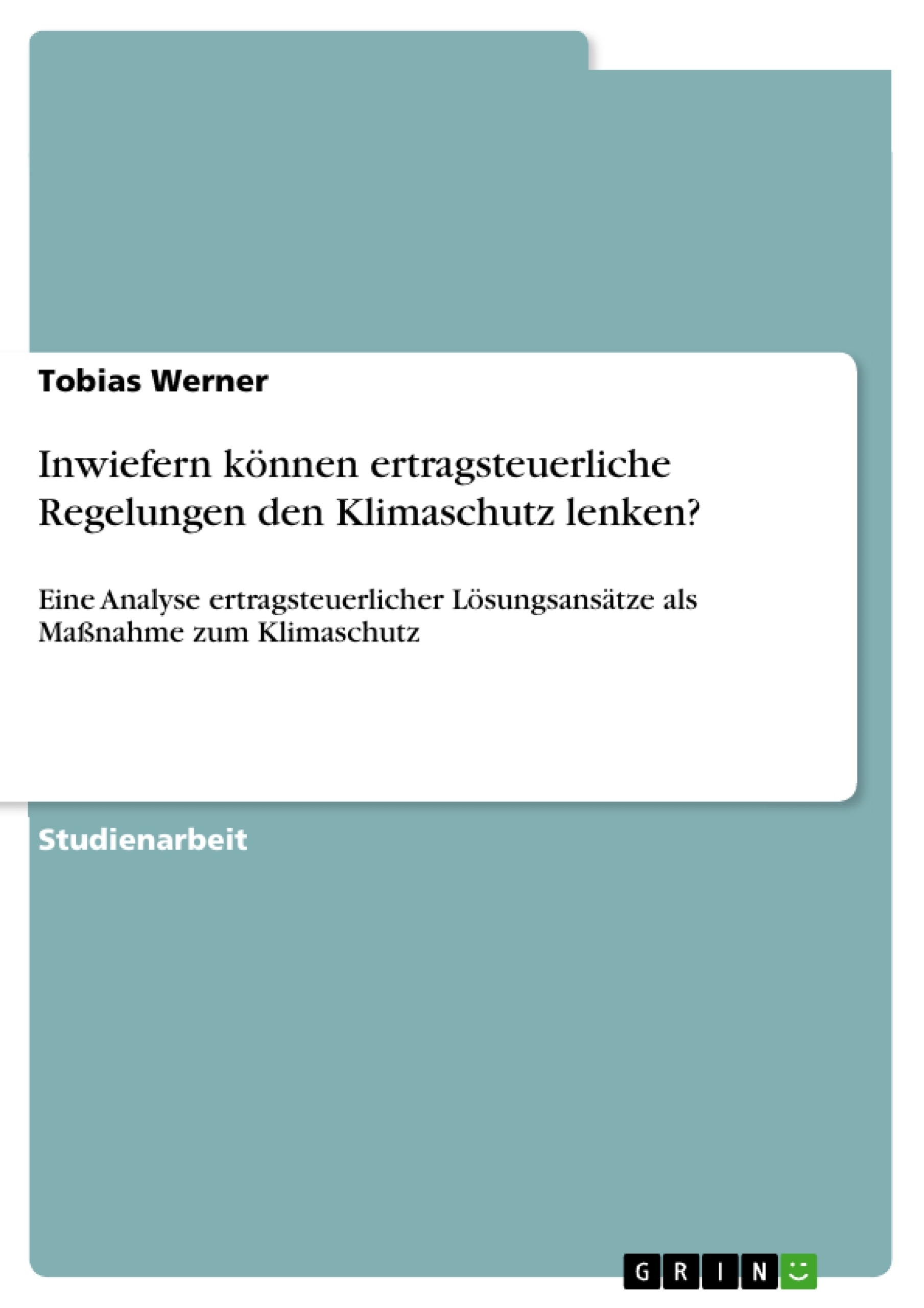Inwiefern können ertragsteuerliche Regelungen den Klimaschutz lenken? Zu Beginn der Arbeit soll kurz auf den Klimawandel als gesellschaftliches Problem eingegangen werden. Anschließend soll es eine Einführung zu den Steuern als Lenkungsfunktion geben. Kapitel 3 stellt einige ertragsteuerliche Lösungsansätze zum Klimaschutz vor. Dabei liegt ein verstärktes Augenmerk auf den ertragsteuerlichen Regelungen zur energetischen Gebäudesanierung und der steuerlichen Förderung von Elektromobilität. Stets sind diese Lösungsansätze kritisch zu hinterfragen sowie deren konkrete Auswirkung auf die Praxis darzustellen.
"We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation who can do something about it." Diese Worte des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama aus dem Jahr 2014 sind auch noch heute, sechs Jahre später, hochaktuell.
Der Klimawandel ist ein allgegenwärtiges Thema und vor allem der Klimaschutz ist in besonderem Interesse der aktuellen und der folgenden Generationen. Doch auch das deutsche Ertragsteuerrecht bestimmt maßgeblich das Leben von 41 Millionen Steuerpflichtigen in Deutschland. Demzufolge könnte das deutsche Ertragsteuerrecht einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Vor über einem Jahr wurde das "Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht" sowie das "Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität" verabschiedet. Darin enthalten sind auch zahlreiche ertragsteuerliche Regelungen, welche einen nicht unerheblichen Teil der deutschen Bevölkerung maßgeblich beeinflussen könnten.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Klimawandel als gesellschaftliches Problem
2.1 Klimaschutz und Klimawandel im Überblick
2.2 Steuern als Lenkungsfunktion
3. Ertragsteuerliche Lösungsansätze
3.1 Energetische Gebäudesanierung nach § 35c EStG
3.1.1 Überblick und Regelungszweck
3.1.2 Voraussetzungen
3.1.2.1 Begünstigtes Objekt
3.1.2.2 Energetische Maßnahmen
3.1.3 Auswirkungen und Kritik
3.1.4 § 35a EStG und § 35c EStG im Vergleich
3.2 Elektromobilität
3.2.1 Sonderabschreibung für Elektronutzfahrzeuge nach § 7c EStG
3.2.1.1 Überblick und Regelungszweck
3.2.1.2 Voraussetzungen
3.2.1.3 Auswirkungen und Kritik
3.2.1.4 Steuerlicher Belastungsvergleich
3.2.2 Reduzierte Bemessungsgrundlage nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG
3.2.2.1 Überblick und Regelungszweck
3.2.2.2 Voraussetzungen
3.2.2.3 Auswirkungen und Kritik
3.2.2.4 Steuerlicher Belastungsvergleich
4. Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis