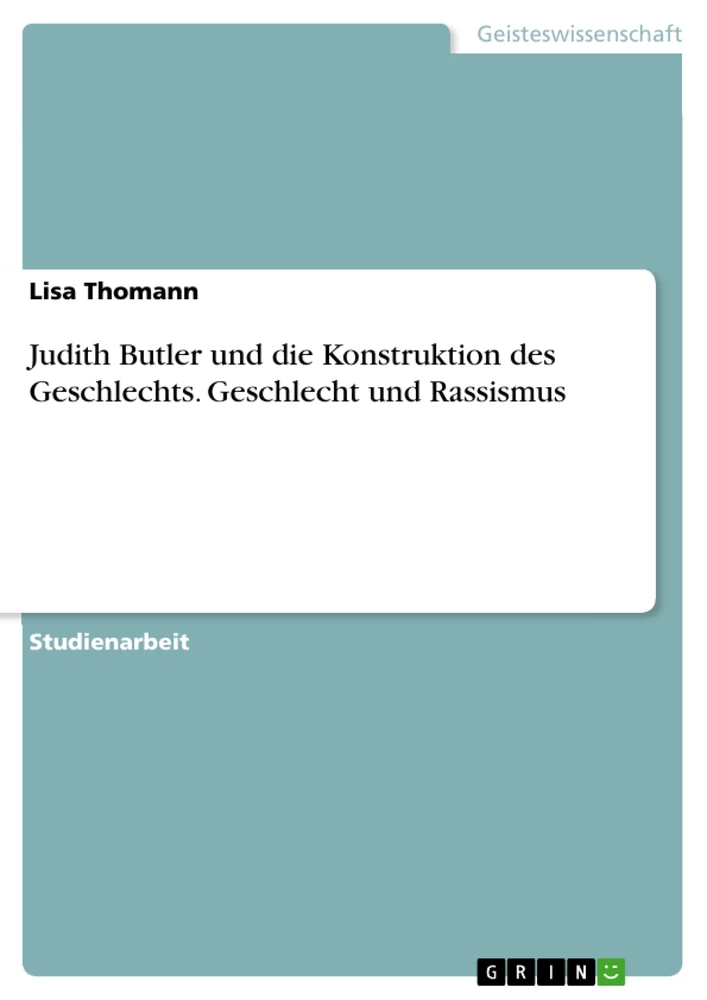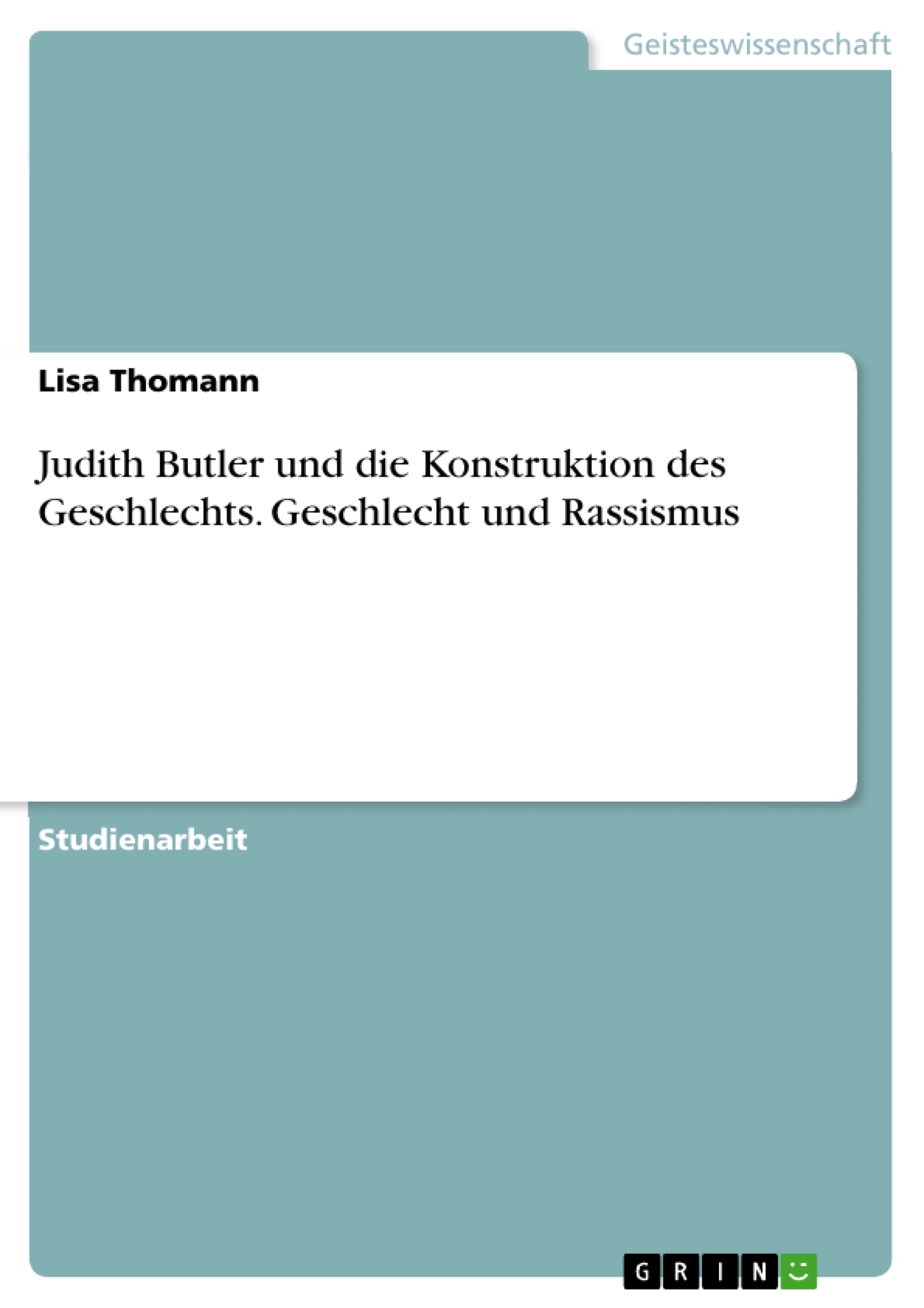In dieser Seminararbeit soll die Theorie, die Judith Butler im Bereich der Gender Studies erschaffen hat, erläutert und auf den Bereich des Rassismus übertragen werden. Die Frage, warum Rassismus nur ein weiteres Konstrukt ist, woher es kommt und wieso man sich diesem so schwer entziehen kann, will die Autorinmithilfe von Judith Butler zu beantworten versuchen.
"Wenn Menschen mich mögen, sagen sie, sie tun es trotz meiner Farbe. Wenn Menschen mich nicht mögen, sagen sie, sie tun es nicht wegen meiner Farbe"So beschreibt der Schriftsteller Frantz Fanon um 1952 den Rassismus in der französischen Kolonie Martinique. Leider hat das Thema keinesfalls an Aktualität verloren. Rassismus, eine Ideologie, die schon seit jeher zu existieren scheint. Wir schreiben ihm eine unendliche Existenz zu und vergessen dabei, dass Geschichte bereits vor ihm begonnen hat. Es scheint jedoch, als sei die Idee der Unterscheidung verschiedener Menschen aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale seit je her existent oder gar natürlich. Doch die geschichtliche Entwicklung des Rassismus beweist das Gegenteil. Es gab eine Zeit ohne Furcht vor dem Fremden, ohne Angst um das Eigene. Seit der Entwicklung des Rassenbegriffs und seiner Anwendung auf Menschen ist der Rassismus in stetiger Veränderung und ein Ende scheint ungreifbar. Doch woher kommt die heute wohl wirkungsmächtigste Ideologie, die wir kennen? Wie konnte sich eine Idee so in die Köpfe der Menschheit einbrennen und die Vernichtung und Unterdrückung Millionen Menschenleben verantworten? In einer entwickelten Welt wie der unseren nimmt der Gedanke an eine Trennung von Rassen noch immer so viel Platz ein, dass man sich doch fragen muss, worauf dieser Gedanke eigentlich basiert und warum er trotz wissenschaftlichen Widerlegungen von Rassen, also trotz der Ablehnung von Rassen im wissenschaftlichen Feld, noch immer so präsent ist.
Auf der Suche nach Ursprüngen war auch die amerikanische Philosophin Judith Butler. In ihrer Schrift «Das Unbehagen der Geschlechter» setzt sie sich mit den Geschlechtskategorien "männlich" und "weiblich" auseinander und versucht die soziale Konstruktion dieses binären Kategoriensystems aufzuzeigen. Judith Butler hat mit ihren Texten nicht nur ein neues, transdisziplinäres Feld etabliert, sondern auch viele verwurzelte Grundannahmen infrage gestellt und angeregt, dies auch auf andere Disziplinen zu übertragen. Alles, was Geschichte hat, ist sozial konstruiert und somit auch veränderbar.
Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
2. SEX UND GENDER
2.1 Sozialkonstruktivismus
2.2 Gender Studies
2.3 Naturvom Körper
2.4 Diskurs und Macht
3. RASSISMUS
3.1 Geschichte des Rassenbegriffs
3.2 Geschichte des Rassismus
3.3 Rassismus heute
4 RACE TROUBLE
5. KONKLUSION
6. LITERATURVERZEICHNIS