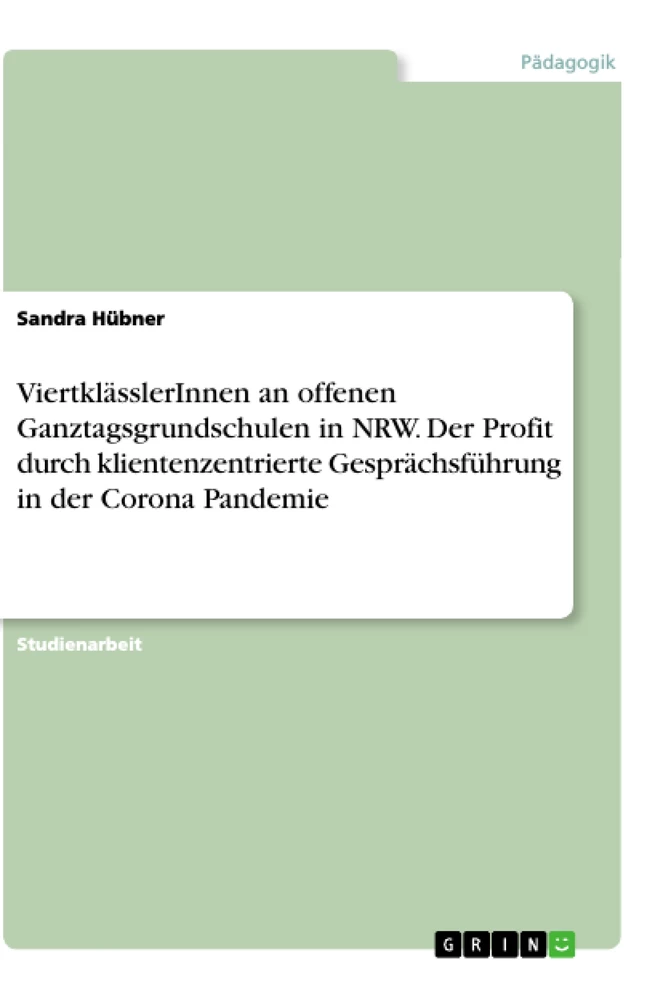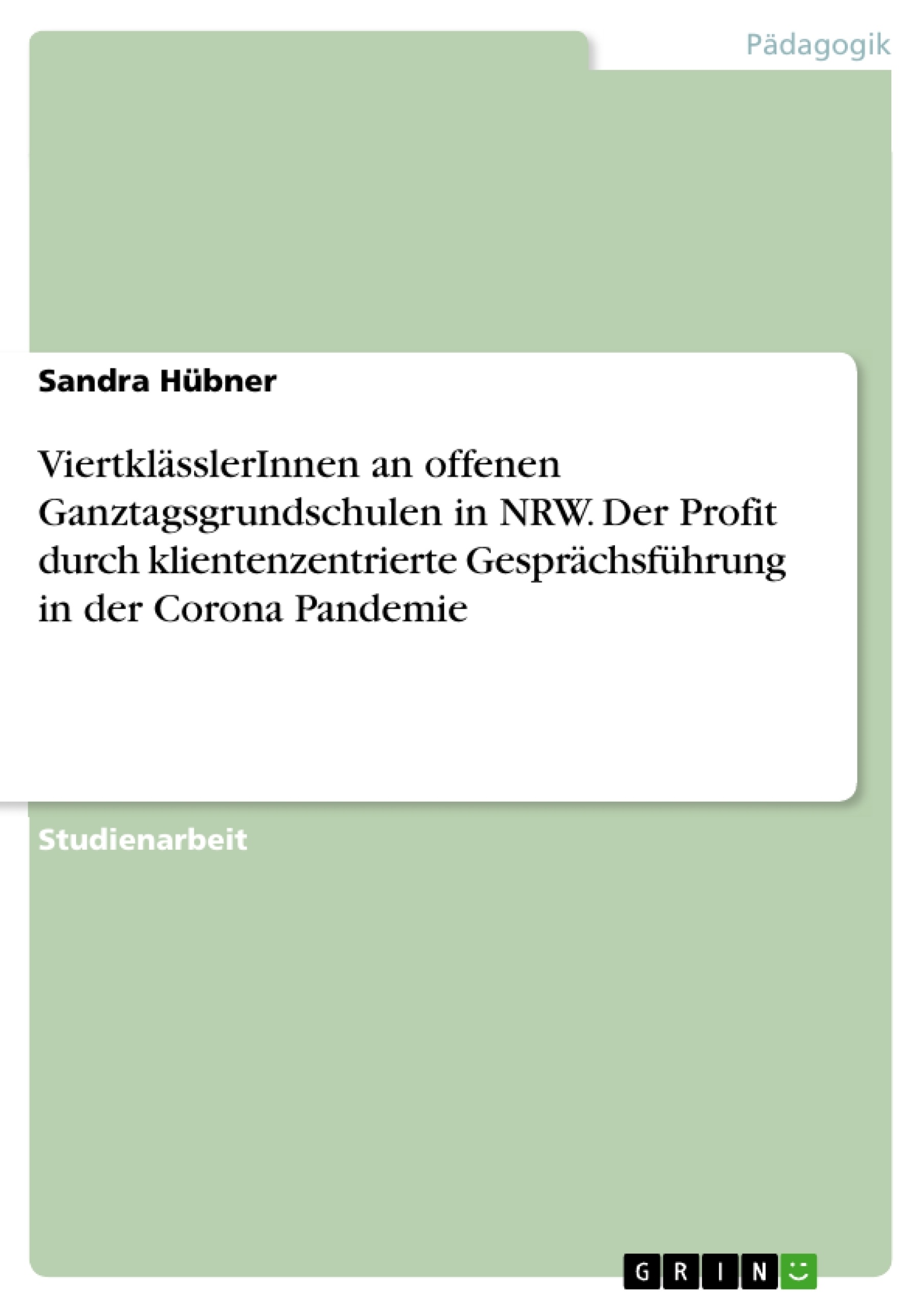Die Arbeit behandelt das Thema, wie Viertklässler*innen an Offenen Ganztagsschulen (OGS) in NRW in Zeiten der Corona-Pandemie durch klientenzentrierte Gesprächsführung profitieren können? Im weiteren Verlauf der Arbeit wird diese Frage beantwortet.
Seitdem die Corona-Pandemie in Deutschland aufgetreten ist und zudem mehrere Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung ergriffen worden sind, durchwandert die Schülerschaft eine sogenannte „Berg- und Talfahrt“ in der Schule wie auch im privaten Umfeld jedes Einzelnen/jeder Einzelnen. Im Frühjahr 2020 kam der erste Lockdown, sprich hierbei wurden diverse Geschäfte und die Betreuungseinrichtungen für Kinder geschlossen. Schrittweise kam die Schülerschaft in NRW in den Grundschulen wieder zum Unterricht (zu Beginn durch Notbetreuung, später „Eintagsmodell“ zur Präsenzpflicht in der Woche, zwei Wochen vor dem Beginn der anstehenden Sommerferien bestand Präsenzunterrichtspflicht).
Nach den Sommerferien wurden alle Schulen wieder geöffnet und es bestand eine Pflicht zum Präsenzunterricht. In diesem Zeitraum konnte die Autorin die Schülerschaft an der OGS näher beobachten und erleben. Zudem gibt es schon eine Bildungsstudie, die im September dieses Jahres veröffentlicht wurde. Die OECD, eine Organisation der sogenannten Industriestaaten, hat Schulschließungen durch die Corona-Pandemie zu späteren Verlusten an Einkommen für die jetzige Generation vorhergesagt. Der Verlust wird sich bis zum Jahrhundertende auf mehrere hundert Milliarden an Euro belaufen.
I. Inhaltsverzeichnis
I. Inhaltsverzeichnis
II. Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Wie profitieren 4. Klässler/Innen durch klientenzentrierte Gesprächsführung?
2.1. Viertklässler/Innen an OGS in NRW
2.1.1. Offene Ganztagsschulen in Nordrhein-Westfalen
2.1.2. Schülerschaft
2.1.3. Pädagogisches Personal
2.2. Corona-Pandemie
2.2.1. Begriffsdefinitionen
2.2.2. Bedeutungen und Auswirkungen auf Schülerschaft und Personal
2.3. Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers
2.3.1. Bedeutung und Hintergrund
2.3.2. Soziale Einzelfallhilfe
2.3.3. Die drei Grundhaltungen
2.3.4. Durchführung der Gesprächsführung
2.4. Praktische Umsetzungen der Gesprächsführung im OGS-Alltag
2.4.1. Praktische Umsetzung nach den Elementen der Gesprächsführung
2.4.2. Praktische Umsetzung anhand der zehn Bildungsbereiche
3. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
II. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Die Autorin der Abschlussarbeit im Studiengang „Psychologischer Beraterin", an der Fernschule für freie Gesundheitsberufe Impulse e.V. in Wuppertal arbeitet selbst als „Staatlich anerkannte Erzieherin" seit mehreren Jahren an diversen Ganztagsschulen. Zurzeit ist sie an einer offenen Ganztagsschule an einer Grundschule als Gruppenleitung von Viertklässlern/Innen tätig. Seitdem die Corona-Pandemie in Deutschland aufgetreten ist und zudem mehrere Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung ergriffen worden sind, durchwandert die Schülerschaft eine sogenannte „Berg- und Talfahrt" in der Schule wie auch im privaten Umfeld jedes Einzelnen/jeder Einzelnen. Im Frühjahr 2020 kam der erste Lockdown, sprich hierbei wurden diverse Geschäfte und die Betreuungseinrichtungen für Kinder geschlossen. Schrittweise kam die Schülerschaft in NRW in den Grundschulen wieder zum Unterricht (zu Beginn durch Notbetreuung, später „Eintagesmodell" zur Präsenzpflicht in der Woche, zwei Wochen vor dem Beginn der anstehenden Sommerferien bestand Präsenzunterrichtspflicht). Nach den Sommerferien wurden alle Schulen wieder geöffnet und es bestand eine Pflicht zum Präsenzunterricht. In diesem Zeitraum konnte die Autorin die Schülerschaft an der OGS näher beobachten und erleben. Zudem gibt es schon eine Bildungsstudie, die im September dieses Jahres veröffentlicht wurde. Die OECD, eine Organisation der sogenannten Industriestaaten, hat Schulschließungen durch die Corona-Pandemie zu späteren Verlusten an Einkommen für die jetzige Generation vorhergesagt. Der Verlust wird sich bis zum Jahrhundertende auf mehrere hundert Milliarden an Euro belaufen. Aber es wird u.a. auch zu einem Produktivitätsverlust beim Menschen kommen. Vor allem Menschen, die aufgrund ihrer Minderbildung bzw. minderen Berufs- bzw. Bildungsabschlüssen werden wenig Zugang zur Arbeit im Onlinebereich finden (OECD, 2020). Jedoch hat auch eine weitere Studie von der DAK Gesundheit folgende Ergebnisse erzielt: jüngere Kinder leiden an emotionalen Schwierigkeiten und fühlen sich nicht mehr so wohl. Davon gaben 37 Prozent der Befragten die Erfahrung mit Stress an, weitere 27 Prozent sprachen von Traurigkeit. Jedes dritte befragte Kind leidet unter psychosomatischen Schwierigkeiten im Bereich von Kopf-, Bauch- und Rückenschmerzen. Eltern sind sehr gestresst und in den Familien gibt es viele Streitpunkte und Zündstoff für Konflikte. Daher haben die Schulschließungen schwere Folgen auf die Entwicklung zur Selbstständigkeit und die Bindungen der bisher erworbenen Beziehung schwächen ab bzw. können ganz verschwinden aufgrund des mangelnden Soziallebens (o.V., 2020). Diese erzielten Inhalte der genannten Studien kann die Autorin der Abschlussarbeit nachvollziehen bzw. erlebt es täglich in der Zusammenarbeit mit Viertklässler/Innen. Die Kinder sind oftmals in schwerwiegende Konflikte verstrickt, dadurch prügeln und beleidigen sie sich gegenseitig. Die Frustrationsschwelle ist derzeit bei den Kindern sehr niedrig und ihnen wird alles schnell zu viel. Aufgrund dieser Beobachtungen hat die Autorin folgende Frage zum Thema der Abschlussarbeit gewählt: Wie können Viertklässler/Innen an OGS in NRW in Zeiten der Corona-Pandemie durch klientenzentrierte Gesprächsführung profitieren? Im weiteren Verlauf der Abschlussarbeit wird diese Frage beantwortet werden.
2. Wie profitieren 4. Klässler/Innen durch klientenzentrierte Gesprächsführung?
2.1. Viertklässler/Innen an OGS in NRW
In diesem Punkt werden die offenen Ganztagsschulen (OGS) in Nordrhein-Westfalen (NRW) (2.1.1.), die Schülerschaft (2.1.2.) und das pädagogische Personal (2.1.3.) näher ausgeführt.
2.1.1. Offene Ganztagsschulen in Nordrhein-Westfalen
Seit dem 21. Jahrhundert spielt die GTS wieder eine besondere Rolle aufgrund schlechter Ergebnisse im Bereich der Schulleistungen (Derecik/Kaufmann/Neuber, 2013, S.23). Die Autorin legt aufgrund ihres derzeitigen Arbeitsbereiches den Schwerpunkt der Abschlussarbeit auf die OGS an GS in NRW. Die OGS in NRW gehören zur Trägerschaft im Bereich der Jugendhilfe und arbeiten u.a. mit Vereinen (Sport), freien Trägern und Musikschulen zusammen. Im Allgemeinen werden Kooperationsverträge zw. dem Träger der Jugendhilfe und den Kommunen (denen die Schulen angehörig sind) geschlossen. Diese Zusammenarbeit wird als „multiprofessionelle Kultur" bezeichnet, sie beinhaltet die Betreuung, Erziehung und Bildung. Daraus werden Konzepte erstellt, die zur Ausgestaltung führen. Die OGS gehören zu den Einrichtungen für Bildung im Alter von 0 bis 10 Jahren der Kinder. In NRW sind sie verpflichtet, sich an die zehn Bildungsbereiche im Handbuch für die Bildungsgrundsätze zu halten (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein- Westfalen/ Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NordrheinWestfalen, 2018, S. 11, 75-133). Die GS sind in den 80er Jahren zu neuen Erkenntnissen gekommen, dass es nicht nur ein Ort für den Unterricht ist. Sondern hierbei handelt es sich um einen Ort im Bereich des Lebens-, Erfahrungs- und Lernraums. Von Natur aus sind Kinder neugierig und lerngewillt (Gudjons, 2008, S. 285). Der Schulort ist im Bereich der Funktion und des Sozialen durch die Leistungen, Selektion, institutionellen Schulordnungen und die Gruppe von Schüler- und Lehrerschaft gekennzeichnet (Schubarth, 2013, S. 45).
2.1.2. Schülerschaft
In den GS sind die Lehrer/Innen die wichtigsten Bezugspersonen für die Kinder und sie orientieren sich an ihnen. In diesem Alter erledigt das Kind die Aufgaben für den Lehrer. Der Schüler kann gute Lernerfolge aufgrund einer positiven Beziehung zum Lehrer erzielen (Winterhoff, 2013, S. 41, 43, 126). Somit hat der Lehrer eine besondere Möglichkeit im Hinblick auf die Entwicklung der Psyche des Kindes, dass es sich von Stufe zu Stufe ohne Hindernisse weiterentwickeln kann (Winterhoff, 2011, S. 48).
2.1.3. Pädagogisches Personal
Wie schon in Punkt 2.1.2. beschrieben, wirkt sich die Qualität der Beziehung zw. Kind und Bezugsperson in der Schule auf die Kindesentwicklung im Bereich der Psyche aus. Die OGS gehört in den meisten Fällen der Jugendhilfe an und sie ist als System der Sozialen Arbeit unterzuordnen. In diesem Berufssektor befinden sich die Sozialpäd./Sozialarb. und Erzieher (Speck, 2007, S. 31).
2.2. Corona-Pandemie
Im weiteren Verlauf werden folgende Unterpunkte aufgeführt: die Begriffsdefinitionen zur CoronaPandemie (2.2.1.) und die Bedeutungen und Auswirkungen der Pandemie auf die Schülerschaft und das pädagogische Personal in Grundschulen bzw. in offenen Ganztagsschulen (2.2.2.).
2.2.1. Begriffsdefinitionen
Corona wird wie folgt definiert: „Corona-Viren sind im Tierreich verbreitete Viren, die beim Menschen in der Regel sog. Erkältungen oder Grippale Infekte (selten Bindehautentzündung, Mittelohrentzündung) hervorrufen (Virus-Erkrankung). Schwere Atemwegserkrankungen sind auf Corona-Viren zurückzuführen ... " (Weerth, o.J., Internetquelle). Der Begriff Pandemie lässt sich wie folgt erklären: „Bei einer Pandemie, d.h. einer länderübergreifenden, kontinentübergreifenden, weltweiten Verbreitung, können erhebliche Gesellschaftskrisen und Wirtschaftskrisen drohen" (Weerth, o.J., Internetquelle).
2.2.2. Bedeutungen und Auswirkungen auf Schülerschaft und Personal
Die Bedeutungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie sind im Bezug auf die Schülerschaft von unterschiedlicher Stärke. Jedes einzelne Kind, das eine GS besucht, findet ein unterschiedliches Zuhause vor. In diesem Zusammenhang möchte die Autorin auf den sozialen Status und das direkte Umfeld des Kindes hinweisen. Viele der Eltern befinden sich durch die derzeitig hohe Arbeitslosigkeit in einem negativen Strudel. Zudem sind die Wissenschaftler der Überzeugung, dass der Anstieg sich weiterhin fortsetzt (o.V., 2020, Folgen des Corona-Lockdowns). Die Elternschaft ist hierbei in eine tiefe Angst versetzt, entweder droht die Arbeitslosigkeit oder sie ist schon vorhanden. Durch diese Ängste erkranken Menschen auch schneller, z.B. am Herzen, Diabetes, z.T. begehen sie auch Selbstmord (Paddock, 2012). Durch die entstandene Problematik kommt hinzu, dass Kinder in Zeiten des Lockdowns und der Eindämmung des Virus vermehrt Zeit zu Hause verbringen. Gerade, wenn Eltern selbst schon in Not sind, hat dies massive Auswirkungen auf die Kinder. Diese Auswirkungen können u.a. Formen der Vernachlässigung, Gewalt, Missbräuche und andere traumatischen Erfahrungen für Kinder, sein (Unicef, 2020). Zudem haben diese Schulschließungen im Frühjahr zu einem Bildungsrückstand geführt. Gerade auch bei Kindern aus sozial schwachen Familien ist das der Fall. Durch das sogenannte Distanzlernen, sprich das Lernen zu Hause, hat durch den sozialen Status einen großen Einfluss darauf, wenn z.B. eine schlechtere Ausstattung an technischen Mitteln in den Familien herrscht (z.B. Computer, Tablet usw.) (Meidin- ger, 2020).
Jedoch hat die Corona-Pandemie u.a. auch langanhaltende Auswirkungen für das weitere Leben der Kinder. Durch die kompletten Schulschließungen im Frühling waren viele Kinder zu Hause in der Onlinewelt unterwegs und haben sich wenig bewegt. Der Mangel an Bewegung hat z.B. Übergewicht zur Folge. Das Übergewicht kann jedoch auch zu Diabetes und Erkrankungen am Herz und im späteren Leben zu Todesfällen und verkürzter Lebensdauer führen. Zudem nimmt dadurch der Konsum der Suchtmittel (Zigaretten, Alkohol, Drogen, Computerspielsucht) stark zu und kann zu den schon bereits genannten Folgen im weiteren Leben führen. Hinzu kommt ein großer Schaden im Bereich der körperlichen, seelischen und sozialen Entwicklung der Kinder. Kinder brauchen für ihre Entwicklung in erster Linie nicht nur ihre Eltern bzw. Bezugspersonen, sondern auch andere Kinder für die eigene soziale Entwicklung. Vor allem aber benötigen sie auch die Fachkräfte an ihrer Seite, die ihnen bestimmte Sachen und Inhalte lehren und beibringen. Die Eltern gehen im größten Fall bereits einem Job nach und können sich unter diesen Bedingungen dem Kind nicht so widmen, wie es eine Institution macht (Spitzer, 2020, S. 134-139).
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben zudem auch Auswirkungen auf das pädagogische Personal in der GS bzw. OGS. In erster Linie hat das Personal selbst mit vermehrten Aufgaben im Bereich der Familie und mit sich selbst zu tun, und zum anderen kommt die Digitalisierung des Unterrichtes als Schwierigkeit hinzu. Insbesondere fehlte in Zeiten des Lockdowns auch die Klassenführung durch die Lehrerschaft. Diese Situation kann wiederum Auswirkungen auf das Mobbing im Onlinekontakt der Schülerschaft haben. U.a. machen sich Lehrerschaft und pädagogisches Personal aus der OGS ihre Sorgen um die Kinder im Bereich der Entwicklung und des alltäglichen Lebens im Miteinander (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2020).
2.3. Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers
Im weiteren Verlauf des Punktes zur klientenzentrierten Gesprächsführung nach Rogers werden die Bedeutung und der Hintergrund (2.3.1.). die soziale Einzelfallhilfe (2.3.2.), die drei Grundhaltungen in der Gesprächsführung (2.3.3.) und zuletzt die Durchführung der Gesprächsführung (2.3.4.) näher erläutert.
2.3.1. Bedeutung und Hintergrund
Carl R. Rogers (1902-1987) war ein amerikanischer Psychologe (Weinberger, 2015, S. 27). Er ist u.a. ein Begründer der Humanistischen Psychologie: „... betont das jedem Menschen innewohnende Bedürfnis nach konstruktiver Veränderung und Selbstverwirklichung“ (Weinberger, 2013, S. 24). Sein Konzept zur Beratung und Therapie wurde nach 1956 von einem Ehepaar der Psychologie aus Hamburg (Annemarie und Reinhard Tausch) mit dem Begriff „Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie“ eingesetzt. (Weinberger, 2013, S. 31). In diesem Zusammenhang steht die Beziehung zum Klienten an erster Stelle und der Ansatz nach Rogers wird wie folgt erläutert: „Ein entscheidendes Kennzeichen des klientenzentrierten Ansatzes ist es, dem Klienten keine Interpretationen, Ratschläge, oder fertige Lösungen anzubieten, sondern die Auseinandersetzung mit emotionalen Prozessen und das Finden neuer Wege und Betrachtungsweisen zu fördern. Dies geschieht mit dem Ziel, den Klienten zu befähigen, auch mit künftigen Problemen besser fertig zu werden“ (Weinberger, 2013, S. 35).
Das Medium der Gesprächsführung ist die Kommunikation. Der Begriff Kommunikation wird wie folgt erläutert: „... als Austausch von Informationen und Gedanken durch sprachliche und/oder nichtsprachliche Mittel (z.B. Körpersprache, Gestik) die Grundlage bildet" (Wendt, 2017, S. 80). Zudem bedeutet Kommunikation u.a. auch Verhalten, schließlich kann ein Verhalten auch nur durch Kommunikation stattfinden bzw. darauf einwirken (Wendt, 2017, S. 80).
2.3.2. Soziale Einzelfallhilfe
Die klientenzentrierte Gesprächsführung kommt in der klassischen Konzeption der Sozialarbeit vor, der sozialen Einzelfallhilfe (social casework) (Weinberger, 2013, S. 38).
Die Soziale Arbeit beinhaltet folgende Methoden: die soziale Einzelfallhilfe, die Gruppenarbeit und die Gemeinwesenarbeit. Die Autorin der Abschlussarbeit legt den Schwerpunkt in diesem Kapitel auf die soziale Einzelfallhilfe und sie wird wie folgt definiert: „Soziale Einzelfallhilfe ist ein Prozess, der von bestimmten Sozialdienststellen angewendet wird, um Menschen zu helfen, mit ihren Problemen im sozialen Bereich besser fertig zu werden" (Galuske, 2013, S. 82). Die Methode erreichte 1926 in Deutschland ihren Bekanntheitsgrad durch das Buch „Soziale Diagnose" von der Autorin Alice Salomon. Zuletzt fand ein wichtiger Import aus Amerika im Jahre 1974 statt. Er beinhaltete einen Sammelband „Konzepte der Sozialen Einzelfallhilfe" von den folgenden Autoren, Robert W. Roberts und Robert H. Nee. Die Einzelfallhilfe wendet sich immer an einzelne Personen. Jedoch wird die Umwelt u.a. auch mitbedacht, schließlich findet immer ein Austausch zw. Individuum und seiner Umwelt statt. In diesem Fall kann dieser Prozess des Austausches, der u.a. auch eine bzw. mehrere Beziehungen darstellen kann, zu Schwierigkeiten in den jeweiligen Beziehungen führen. Diese Beziehungsschwierigkeiten werden als die Ursache für hilfesuchende Menschen angesehen. Hierbei bekommt die hilfesuchende Person durch die Einzelfallhilfe eine Unterstützung zur Lösungsorientierung. In diesem Hinblick wirkt die Einzelfallhilfe als therapeutische Intervention, die durch eine Veränderung im Bereich der Einstellungen und des Verhaltens der betroffenen Person zur Verbesserung der jeweiligen Lebenslage führt. Das wichtigste Handwerkszeug ist die Beziehung zw. der betroffenen Person und dem Sozialarbeiter. Zudem sollte das Vertrauen im Mittelpunkt der Beziehung stehen. Nur auf diesem Fundament kann dieser Hilfeprozess entstehen bzw. basieren. Das Ziel in diesem Prozess ist das Wachstum des Wohlergehens, auch Wohlbefinden genannt. Dies kann durch Veränderungen von Verhaltensweisen, Muster von Interpretationen und der Wahrnehmung erreicht werden (Galuske, 2013, S. 75-114).
Der Ansatz lässt sich u.a. auch in der Beratung mit Kindern wiederfinden und anwenden und wird wie folgt näher erklärt: „War Beratung früher in erster Linie mit Rat, Informationen, Auskunft geben verbunden, ... hin zu einer Betonung der Beziehung und einer Orientierung an der Person und ihren Fähigkeiten, zu eigenen Lösungen zu kommen" (Weinberger, 2015, S. 23). Rogers hat mehrere Jahre in der Erziehungsberatung mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet. Seine Ansätze lassen sich heutzutage in der Arbeit beim Kinderschutz (konkrete Hilfeplanung), im Konzept von Behandlungen im Bereich der klinischen Sozialarbeit und in der Erziehungsberatung wiederfinden (Weinberger, 2013, S. 163).
2.3.3. Die drei Grundhaltungen
In der Therapie gibt es drei bedeutsame Grundhaltungen, die ein Therapeut in seiner Anwendung einbringen sollte: „Einfühlendes Verstehen" (Empathie), „Unbedingte Wertschätzung" (Akzeptanz) und „Kongruenz" (Authentizität) (Weinberger, 2013, S. 32) Im weiteren Verlauf werden diese drei Grundhaltungen näher beleuchtet.
Einfühlendes Verstehen (Empathie) wird wie folgt definiert: „Empathisches Verstehen bedeutet „den inneren Bezugsrahmen des anderen möglichst exakt wahrzunehmen, mit all seinen emotionalen Komponenten und Bedeutungen, gerade so, als ob man die andere Person wäre, jedoch ohne jemals die „Als-ob" - Position aufzugeben" (Weinberger, 2013, S. 41). Hierbei ist wichtig, dass der Berater die Empfindungen der Gefühle des Klienten wahrnimmt (Vorstellungen, Einstellungen, Werte) und diese versucht zu verstehen, um es im Anschluss fast fehlerfrei dem Klienten mitzuteilen. Entsprechend kann der Klient aus der Entfernung heraus diese Empfindungen spüren und dies ermöglicht eine Umgestaltung der Einstellungen und Werthaltungen. Durch die ständige Wahrnehmung der Empfindungen seitens Berater gegenüber dem Klienten, wird der Klient dazu stimuliert, sich mit seinem inneren Gefühls- und Empfindungserleben auseinanderzusetzten. Durch diesen Prozess lernt der Klient entsprechend seine inneren Ziele und Wünsche zu konkretisieren bzw. zu differenzieren und somit ist dies zielführend für die Klärung der inneren bzw. externen Konflikte. Rogers hat hieraus keine Technik festgelegt, wie der Berater die Empathie seinem Klienten mitteilen kann. Sondern der Vorgang wird wie folgt erläutert: „So wurde das empathische Verstehen auf „die Worte des Klienten spiegeln" reduziert" (Weinberger, 2013, S. 41). Wichtig beim Spiegeln ist die Anwendung der „einfachen Sprache", z.B. die Benutzung einfacher und häufiger gebrauchter Wörter und kurzer Sätze, keine Fachwörter bzw. Fremdwörter benutzen. Hierbei sollten u.a. die Adjektive, Verben und Adverbien den Substantiven vorgezogen werden und zum praktischen Einsatz kommen. Sie sind zudem gefühlvoller und persönlich an den Klienten gerichtet. Das empathische Verstehen beinhaltet eine weitere Komponente, das sogenannte empathische Zuhören. Es gehört zu den Grundprinzipien eines Gespräches zw. Berater und Hilfesuchenden. Um das emotionale Innere des Klienten wahrnehmen zu können, sollte der Berater hierbei konzentriert und aufmerksam zuhören, was der Klient an gefühlvollen verbalen Inhalten wiedergibt. In diesem Sinne sind u.a. auch das Tempo und die Pausen de Sprache bedeutend, zudem der Tonfall und visuell, sind die Mimik und Gestik wahrzunehmen. Auf Basis einer konzentrierten Wahrnehmung seitens Berater gegenüber dem Klienten kann er verbale und nonverbale Signale aufnehmen, sie einordnen und entsprechend handeln und kommunizieren.
Die zweite Grundhaltung in der Anwendung ist die unbedingte Wertschätzung (Akzeptanz) und wird wie folgt definiert: „... bedeutet, „eine Person zu schätzen, ungeachtet der verschiedenen Bewertungen, die man selbst ihren verschiedenen Verhaltensweisen gegenüber hat" (Weinberger, 2013, S. 59). Diese Definition sagt aus, dass eine Beziehung unbedingt positiv ist und den Klienten so annimmt und akzeptiert, unabhängig von seinen verbalen Aussagen. Hierbei geht es um die Akzeptanz unabdingbar von Erwartungen und irgendwelchen an ihn geknüpften Bedingungen. In diesem Sinne kann der Klient dem Berater gegenüber Vertrauen in der Beziehung durch diese vollkommene Akzeptanz entgegenbringen und dies stärkt die bestehende Beziehung zw. ihnen.
Die letzte und dritte Grundhaltung ist die Kongruenz (Authentizität) und lässt sich wie folgt definieren: „Kongruenz bedeutet, dass die Beraterin sich dessen, was sie erlebt oder empfindet, deutlich gewahr wird, dass ihr diese Empfindungen verfügbar sind und sie dieses Erleben in den Kontakt mit der Klientin einbringt, wenn es angemessen ist" (Weinberger, 2013, S. 66). Diese Erklärung drückt aus, dass Kongruenz eigentlich ein Gleichklang mit sich selbst ist. Für Rogers war es der bedeutsamste Aspekt (Bedingung), der einen Verlauf positiv in der Therapie bzw. in der Beratung unterstützen kann. Zudem wird heute eher der Begriff „Authentizität“ benutzt und bedeutet so viel, wie ein „Offensein“ für sich selbst und seine eigenen Erfahrungen im Bereich des Erlebens (Weinberger, 2013, S. 41-68).
2.3.4. Durchführung der Gesprächsführung
In diesem Kapitel werden die Elemente im Gespräch der Beratung näher erläutert. Zu Beginn wird der äußere Rahmen mit den Punkten, die Vorinformationen, die Gesprächsatmosphäre und der Dauer und Häufigkeit, vorgestellt. Der Punkt Vorinformationen beinhaltet die Erwartungen des Klienten. Es kommt immer darauf an, ob die Beratung einmalig oder mehrmalig stattfindet. Einige Klienten erwarten schnelle Lösungsvorschläge, ohne dabei großartig aktiv zu sein. Dabei ist es wichtig, mit dem Klienten zu klären (falls die Beratung über einen längeren Zeitraum geht), dass seine Schwierigkeiten im Mittelpunkt stehen und er zur Selbsthilfe angeleitet wird. Jedoch bei Kindern im Grundschulalter empfiehlt die Autorin einen schnelleren Einsatz von Lösungsmöglichkeiten anzubieten. In diesem Alter lernen Kinder im Verhalten und im sozialen Miteinander. Der zweite Unterpunkt beschreibt die Gesprächsatmosphäre. Hierbei geht es nicht um eine Sitzordnung, sondern um die Atmosphäre. In diesem Fall ist die Umgebung der stattfindenden Beratung gemeint und dabei können folgende Punkte beachtet werden: Die Sitzplatzgestaltung (sich schräg gegenübersitzen - kein frontales Sitzen, evtl. einen kleinen Tisch zwischen Gesprächspartnern platzieren, offene Sitzhaltung eingehen), die Ruhe (kein Telefon, Schild an die Türe hängen, Störungen vermeiden) usw. Im weiteren Unterpunkt sind die Häufigkeit und Dauer benannt. Diese sollte eine bestimmte Regelmäßigkeit und Dauer haben, hängt jedoch vom Faktor der jeweiligen Situation ab (z.B. könnte die Beratung einmal in der Woche für 30 - 50 Minuten erfolgen).
[...]