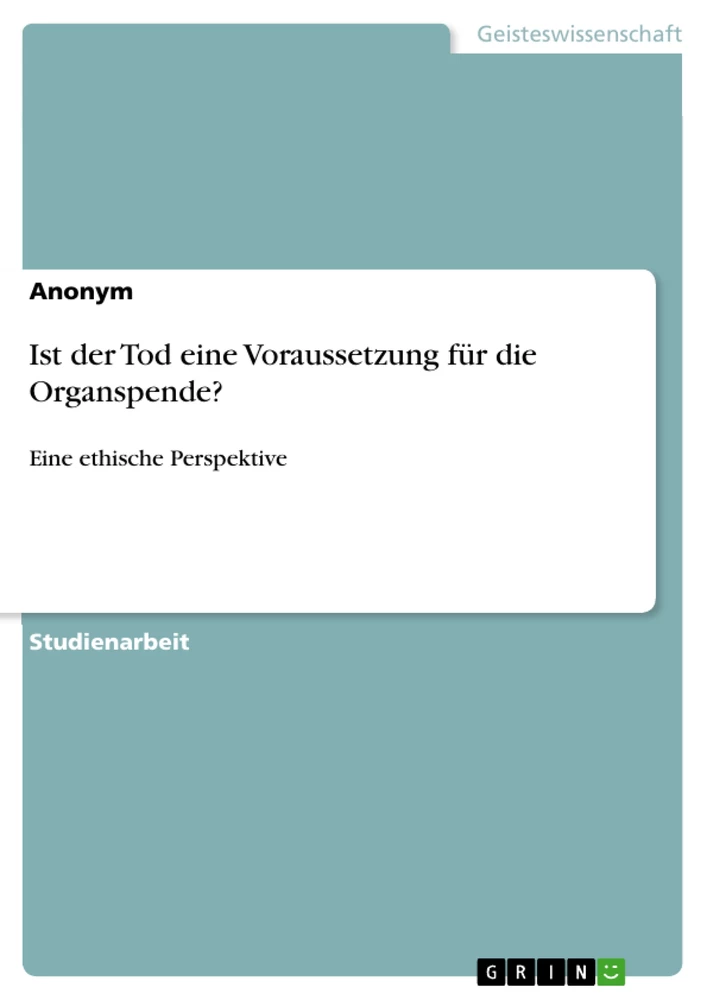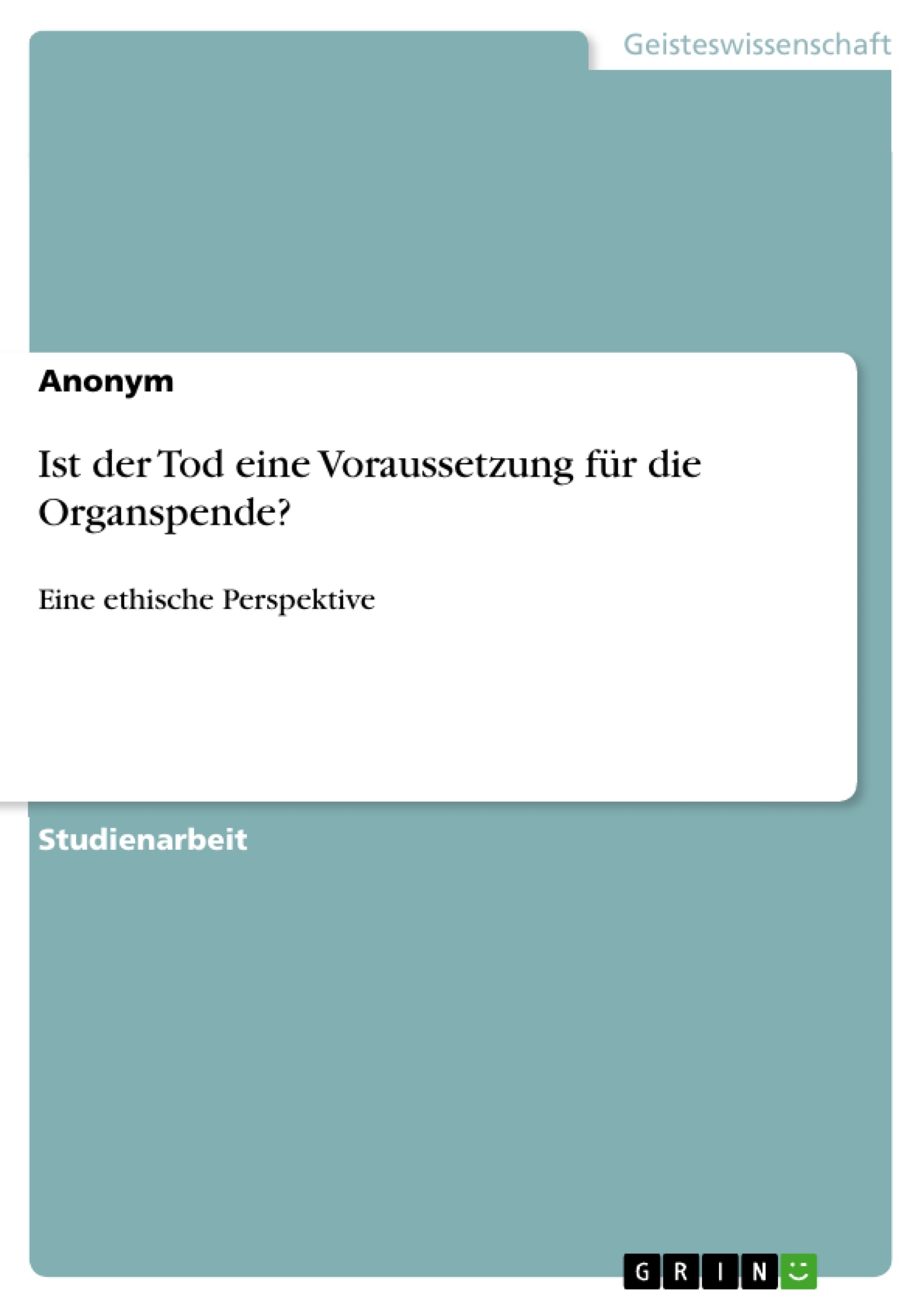Es ist immer häufiger zu beobachten, wie die Menschen mit dem Thema Organspende konfrontiert werden. Ein Thema, worüber viele Menschen ungern reden, da es eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod mit sich zieht, was auch noch heute tabuisiert wird. Dies ist allerdings nicht so leicht zu verdrängen, wie es sicher die meisten versuchen, denn durch vielfältige Werbeplakate wird man daran erinnert. Zudem sieht man prominente Personen, wie beispielsweise den Olympiasieger Matthias Steiner und die Moderatorin Sonja Kraus in der Werbung, die sich für einen Organspendeausweis entschieden haben und schließlich hält man eines Tages den Organspendeausweis, nach dem entleeren des Briefkastens, in den Händen.
Jetzt oder nie. Was spricht schon dagegen? Man selbst könnte eines Tages auf einen Spender angewiesen sein und was soll mir, als Spender, schon zustoßen, schließlich bin ich doch dann schon tot, oder nicht? Was bedeutet tot sein und inwiefern ist der Tod für eine Organtransplantation notwendig? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigte sich der Philosoph Prof. Dr. Ralf Stoecker und verfasste dazu im Jahr 2012 einen Artikel in der „Zeitschrift für medizinische Ethik“. Die leitende Frage des Autors lautet darin: „Ist der Tod aus ethischer Sicht eine Voraussetzung für die Organspende?“. Ein kleiner geschichtlicher Rückblick soll erklären, warum diese Frage noch heute für uns von Interesse ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Rekonstruktion: „Der Tod als Voraussetzung der Organspende?“ (Ralf Stoecker)
2.1 Die Debatte: Hirntod
2.2 Herzstillstand, der Umstand der Organtransplantation
2.3 Von der Hirntod-Konzeption zur ethischen Organentnahme
2.4 Ethische Merkmale der Organentnahme
3. Kritik
4. Fazit