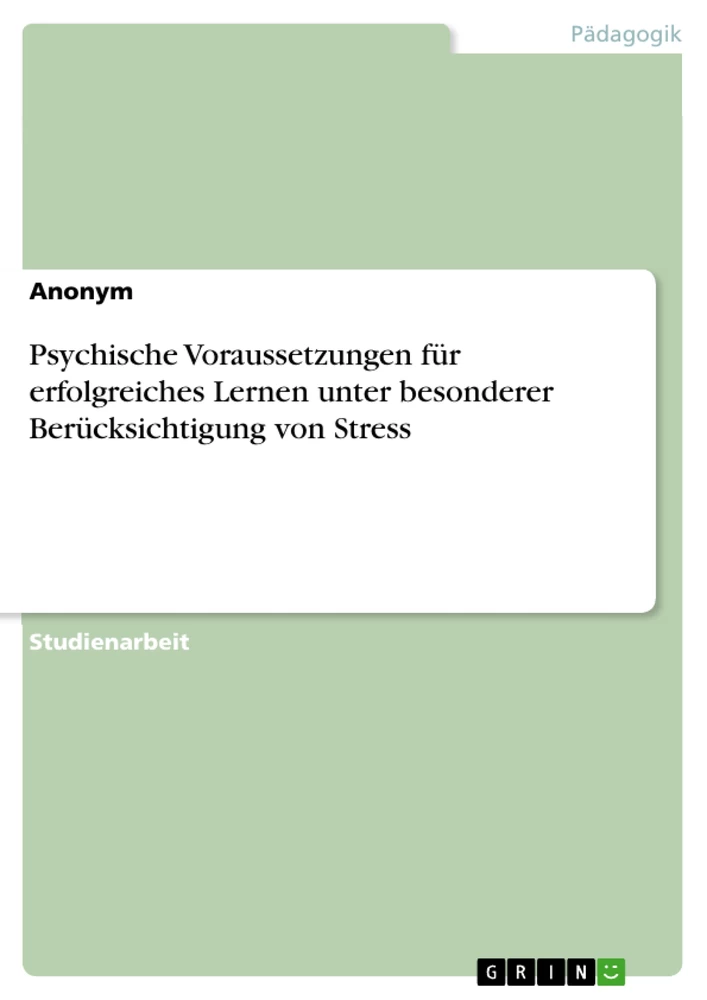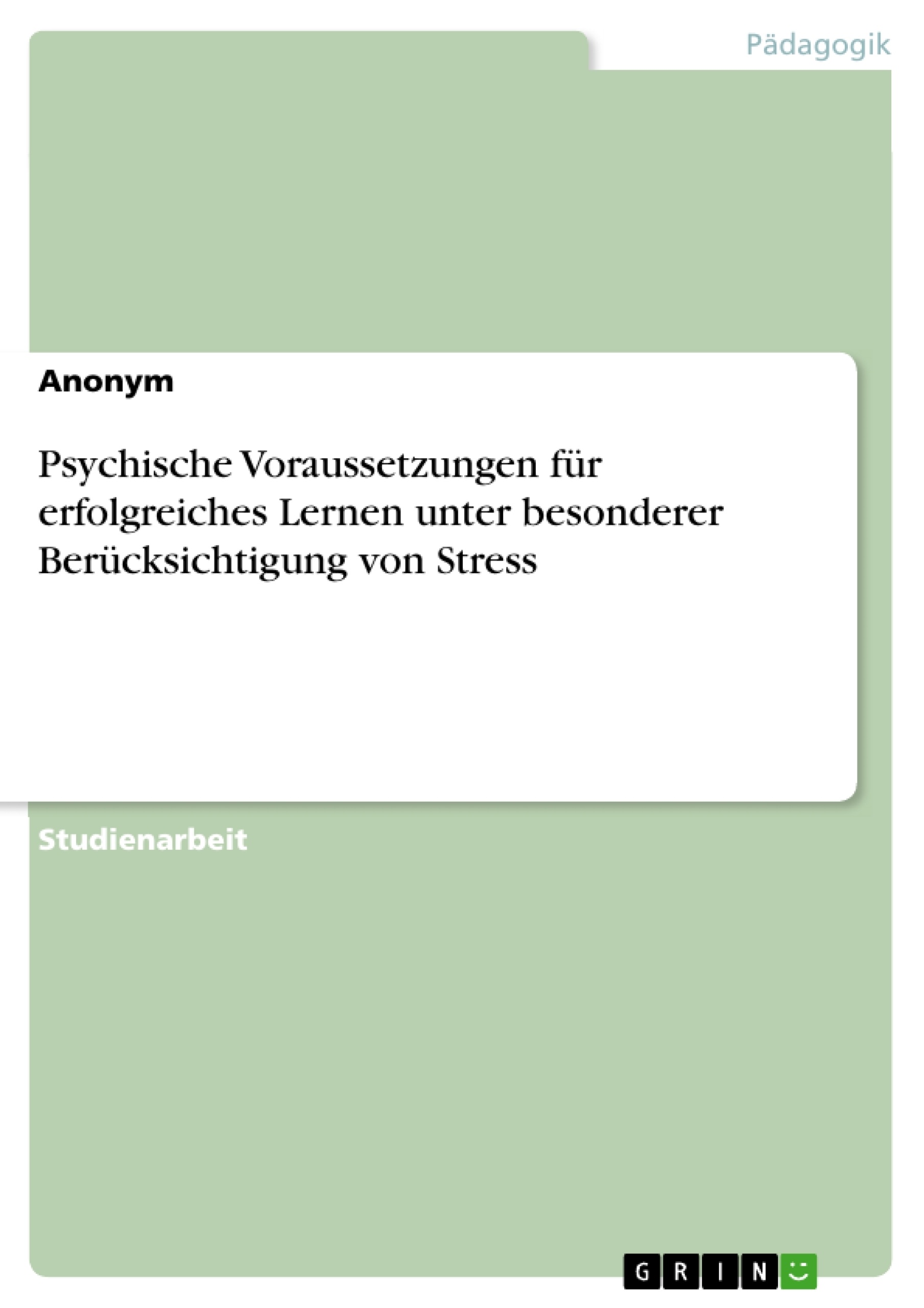Der Gebrauch des Wortes Stress zählt für die meisten Menschen inzwischen zum Alltag. Häufig werden sie mit Stressauslösern verbunden, die sich auf der Arbeit, Daheim oder in ihrer freien Zeit befinden können. Bereits Kinder nehmen sich dem Begriff an und nutzen ihn, um deren Belastung zu signalisieren. Ihre Klagen handeln beispielsweise von Stress mit Freunden, Schulstress oder Eltern, die sie „stressen“.
Stress ist wie ein Gewürz – die richtige Menge bereichert den Geschmack eines Gerichts. Zu wenig lässt das Essen fade schmecken, zu viel schnürt einem den Hals zu. Die Analogie verdeutlicht, dass Stress in erster Linie keiner negativen Bewertung unterliegen muss, doch kann sie die Gesundheit gefährden. Kinder und Jugendliche sind in der Regel nicht so belastbar, dass sie allen Anforderungen gerecht werden können. Die Gefahr liegt dabei in der Unfähigkeit der Stressbewältigung.
Da die Kinder und Jugendlichen die meiste Zeit ihres Lebens in der Schule verbringen, ist es sinnvoll, ihnen dort den Umgang mit Stresssituationen näher zu bringen. Nicht jede schulische Institution hat die Möglichkeit, auf eine Fachkraft der Schulsozialarbeit zurückzugreifen. Aus diesem Grund sehe ich mich als angehende Lehrkraft in der Pflicht, mich dem Thema anzunehmen und meinen zukünftigen Schülerinnen und Schülern in ihren Stresssituationen zu unterstützen.
Um eine begleitende Funktion zur Stressbewältigung der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, ist es zunächst notwendig, sich mit der theoretischen Grundlage von Stress vertraut zu machen. Für eine erste Annäherung des Themas setzt sich die Arbeit mit der Definition des Stressbegriffs auseinander. Vorerst liefert die Studie des Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung IFT-Nord Forschungsergebnisse über die Häufigkeit des Stresserlebens von jungen Menschen und deren Auswirkungen. Im nächsten Schritt zeigt die Arbeit institutionelle Trainingsprogramme auf, die die Heranwachsenden im Kontext der Schule berücksichtigt. Abschließend werden empfohlene Umgangsformen und Bewältigungsstrukturen angeführt, die das Stresserleben der Kinder und Jugendliche reduzieren und von Lehrkräften im Unterricht integriert werden können.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Forschungsstand der IFT Nord und DAK Gesundheit
2. Stress als Phänomen
2.1 Stress-Modell von Lazarus
3. Trainingsangebote zur Stressbewältigung
3.1 weitere Unterstützungsmöglichkeiten
4. Schlussfolgerung
Anhang
Quellenverzeichnis