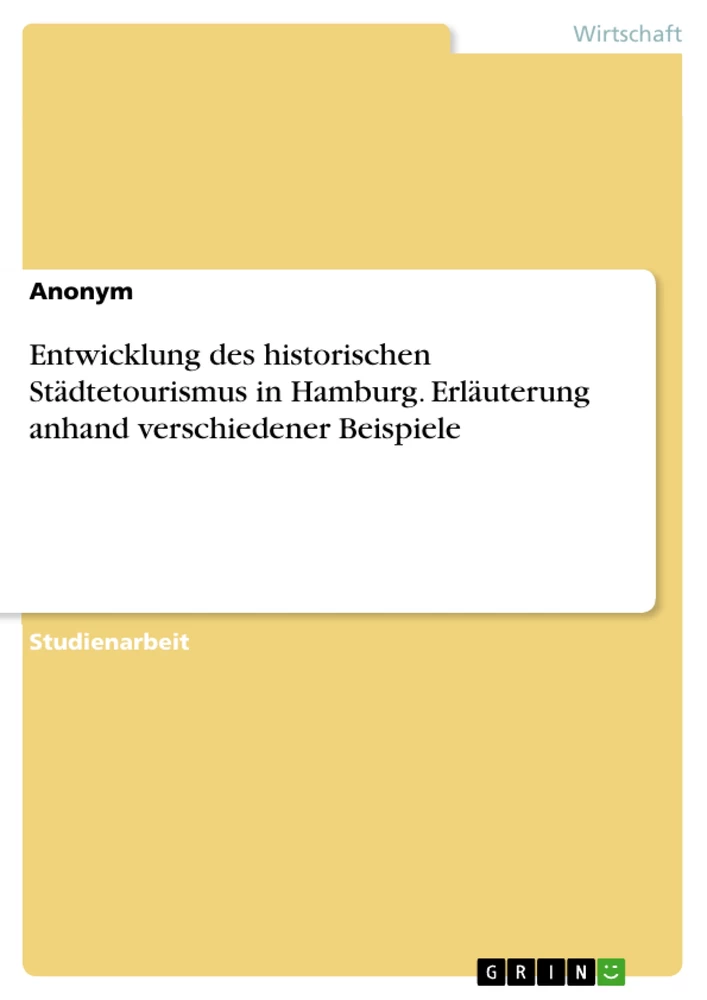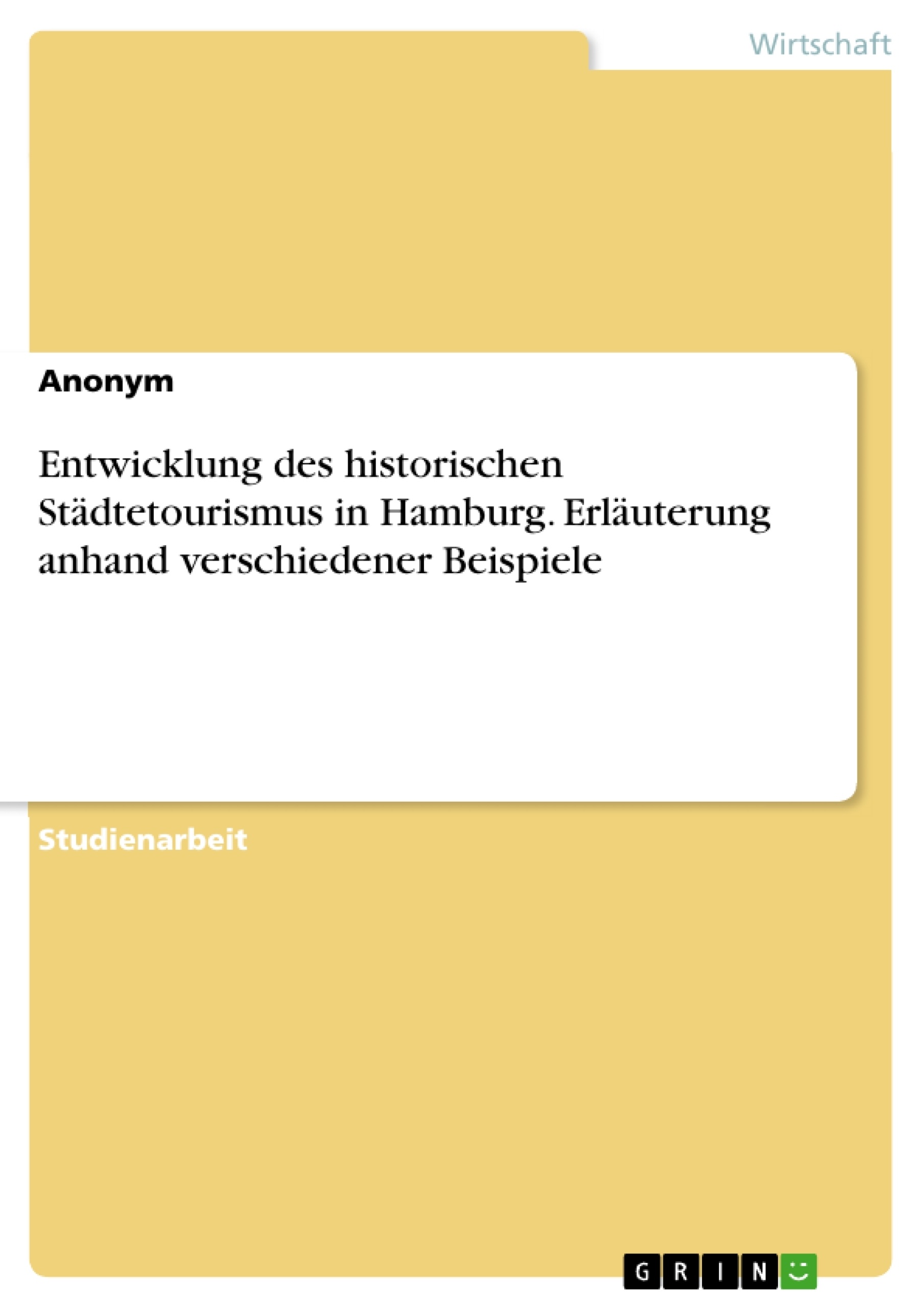Wo und wie hat sich der Tourismus in Hamburg entwickelt? Welche Auswirkungen brachte der Tourismus? Diese Hausarbeit beleuchtet die geschichtliche Entwicklung anhand mehrerer Beispiele und Institutionen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die zeitliche Entwicklung von Hamburgs Tourismus herauszuarbeiten und Faktoren aufzuzeigen, die auf mögliche Chancen und Risiken Einfluss nahmen.
Zu Beginn wird der Faktor Wahrzeichen genauer betrachtet, um dem Leser aufzuzeigen, welchen Einfluss dieser auf die touristische Entwicklung einer Stadt oder eines Landes haben kann. So wird als Erstes der nötige Kontext geliefert. Im zweiten Abschnitt wird auf konkrete beispielhafte Wahrzeichen und deren Entwicklung in Hamburg eingegangen. Indem der geschichtliche Entwicklungsprozess die Rahmenbedingungen bietet und bereits einige Chancen und Risiken aufzeigt, kann im dritten Sinnesabschnitt auf die Folgen für den Städtetourismus in Hamburg eingegangen werden. In diesem können dann die vorherigen Grundlagen geeint werden und die Fragestellung bearbeitet werden. Unterstützt wird das ganze besonders durch die bereits genannten Beispiele. Als abschließend fungiert dann der Schlussteil.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
Hintergrund der Arbeit
Zielsetzung und Vorgehensweise
Grundlagen
Definition Städtetourismus
Definition Destination
Touristische Nachfrage
Hamburger Hafen
Geschichtliche Entwicklung
Speicherstadt
Musicals
Reeperbahn
Geschichtliche Entwicklung
Große Freiheit
St. Pauli
Hamburger Dom
Alster
Alsterschwäne
Freizeitgestaltung
Alstervergnügen
Hauptkirche St. Michaelis
Zusammenfassende Schlussbemerkungen
Auswertung
Ausblick
Literaturverzeichnis
Bücher und Studien
Internetquellen
Sonstige